 Die Belgier sprechen dieses Jahr von der „Mutter aller Wahlen“. Denn am Sonntag wählen sie bei bloß einem Urnengang gleichzeitig die Regionalparlamente Flanderns, Walloniens und Brüssels sowie der deutschsprachigen Gemeinschaft, die belgische Abgeordnetenkammer und das Europaparlament. flanderninfo.be veröffentlichte die Erfahrungen von EU-Ausländern, die im politisch etwas komplizierter gestrickten Belgien leben. Ihre Statements erschienen zwei Wochen lang täglich in einer interaktiven Grafik.
Die Belgier sprechen dieses Jahr von der „Mutter aller Wahlen“. Denn am Sonntag wählen sie bei bloß einem Urnengang gleichzeitig die Regionalparlamente Flanderns, Walloniens und Brüssels sowie der deutschsprachigen Gemeinschaft, die belgische Abgeordnetenkammer und das Europaparlament. flanderninfo.be veröffentlichte die Erfahrungen von EU-Ausländern, die im politisch etwas komplizierter gestrickten Belgien leben. Ihre Statements erschienen zwei Wochen lang täglich in einer interaktiven Grafik.
Auf der deutschsprachigen Website flanderninfo.be startete die Redakteurin Uta Neumann vier Wochen vor den Wahlen einen Aufruf an EU-Ausländer in Belgien. Mit der Bitte, sechs Fragen zu beantworten und sie per Mail an die Redaktion zu schicken.
„Darauf meldete sich leider kaum jemand. Erst als ich Mails direkt an Expats und Deutsche in Belgien schickte, antworteten dann doch noch einige“, erzählt Neumann.
Ein Expatriate kurz Expat (aus dem Lateinischen: ex aus, heraus und patria Vaterland), heißt eine Fachkraft, die ihr international tätiger Arbeitgeber vorübergehend an eine ausländische Zweigstelle des Unternehmens entsendet.
Eine Auswahl der Antworten veröffentlichte die Redaktion täglich in einer interaktiven Grafik im Dossier Wahlen Mai 2014. Jeweils mit Vollnamen oder auf Wunsch mit Kürzel oder anonym. Zudem war die Angabe von Staatsangehörigkeit, Alter und bisherige Dauer des Belgienaufenthalts freiwillig.
drehscheibe-Tipp
Weitere Geschichten über EU-Ausländer in der Region:
- EU-Ausländer wählen bei Kommunalwahlen und Europawahl
- Gelebte Gemeinschaft: EU-Ausländer in der Region
- EU-Ausländer leben Europa im tiefsten Schwabenland
Die Fragen
- Warum gehen Sie zur Europawahl 2014?/Warum gehen Sie nicht wählen?
- In welchem Land (Heimatland oder Belgien) wählen Sie? Warum?
- Warum wünschen Sie sich mehr oder weniger Europa?
- Was sind Ihre Erfahrungen mit den Europawahlen? Wie schwierig war die Anmeldung zur Europawahl?
- Wer, denken Sie, wird aus den Wahlen als Sieger hervorgehen?
- Wie viel bekommen Sie von den belgischen Listen für die Europawahlen mit?
Auswahl eingesendeter Antworten:
Mittwoch, 7 Mai:
1 ) Was sind Ihre Erfahrungen mit den Europawahlen? Wie schwierig war die Anmeldung zur Europawahl?
Die Anmeldung ist nicht schwierig – nicht schwieriger als für andere Wahlen. Die Botschaft informiert Auslandsdeutsche sehr gut über die Prozeduren. (S.Z., 34 Jahre aus Deutschland, lebt in Belgien)
2) Wer, denken Sie, wird aus den Wahlen als Sieger hervorgehen?
Persönlich glaube ich, dass wieder die Konservativen die stärkste Fraktion werden. (S.Z., 34 Jahre aus Deutschland, lebt in Belgien)
3) Wie viel bekommen Sie von den belgischen Listen für die Europawahlen mit?
In Belgien stehen die nationalen und regionalen Wahlen im Vordergrund. (S.Z., 34 Jahre aus Deutschland, lebt in Belgien)
Video-Tipp
Einen kurzen Einblick in das komplexe politische System Belgiens mit seinen bemerkenswerten Eigenheiten gibt dieses unterhaltsame Video (in Englisch):
Donnerstag, 15. Mai:
1) In welchem Land (Heimatland oder Belgien) wählen Sie? Warum?
Ich lebe und arbeite in Brüssel (ursprünglich aus Deutschland), weil hier Europäische Gesetzgebung auf den Weg gebracht wird. Es handelt sich zudem um eine Internationale Stadt, wo man Einblicke in verschiedene Kulturen gewinnen kann und so einen anderen Blick auf Europa als Ganzes bekommt. 28 Nationalitäten – Zusammen sind wir Europa – Alle ein wenig anders, aber doch vereint. Das hautnah zu erleben, ist die Reise schon wert! (T.H., 27 Jahre, aus Deutschland)
2) Warum wünschen Sie sich mehr oder weniger Europa?
Ich stehe ein für die Idee Europas – dass sich 28 Länder vereinen und zusammen ein Ganzes bilden. Dank Europa haben wir vieles erreicht. Jeder kann verreisen wohin er auch will, wir müssen kein Geld wechseln aufgrund der gemeinsamen Währung, es gibt keine Kriege und und und… Die Liste ist lang. Fakt ist: Europa bringt uns mehr Vorteile als Nachteile. (T.H., 27 Jahre, aus Deutschland)
3) Wie schwierig war die Anmeldung zur Europawahl?
Die Anmeldung zur Europawahl war kinderleicht und unproblematisch (Deutsche, seit 23 Jahren in Belgien.)
Freitag, 16. Mai:
1) Warum gehen Sie zur Europawahl 2014?/Warum gehen Sie nicht wählen?
Nicht weil es Wahlpflicht ist, sondern um der Sache willen. (RE.BE. aus Deutschland, lebt in Belgien)
2) In welchem Land (Heimatland oder Belgien) wählen Sie? Warum?
In Belgien, weil wir hier leben. (RE.BE. aus Deutschland, lebt in Belgien)
3) Warum wünschen Sie sich mehr oder weniger Europa?
Ich wünsche mir mehr Europa, weil die Europa-Idee von vor 50 Jahren unterzugehen droht. (RE.BE. aus Deutschland, lebt in Belgien)Montag: 19.05.14
1) Was sind Ihre Erfahrungen mit den Europawahlen? Wie schwierig war die Anmeldung zur Europawahl?
Bürokratisch zu umständlich, daher habe ich mich entschlossen meine Skepsis gegenüber der jetzigen Gestalt der EU und ihre ungenügende demokratische Legitimierung durch Nichtwahl auszudrücken. (Aus Deutschland, 52 Jahre)
2) Wer, denken Sie, wird aus den Wahlen als Sieger hervorgehen?
Den Sieger kann ich nicht einschätzen, aber die eurokritischen Stimmen werden stärker. (Aus Deutschland 52 Jahre)
3) Wie viel bekommen Sie von den belgischen Listen mit?
Unbedeutend (Aus Deutschland 52 Jahre)
Kontakt zu den Machern
Uta Neumann
VRT-Online-Redakteurin
Mobiltelefon: +32 (0) 474 911 262
Mail: uta.neumann°ät°vrt°punkt°be
flanderninfo.be
flanderninfo.be ist die deutschsprachige Website von VRT, dem flämischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Belgien.

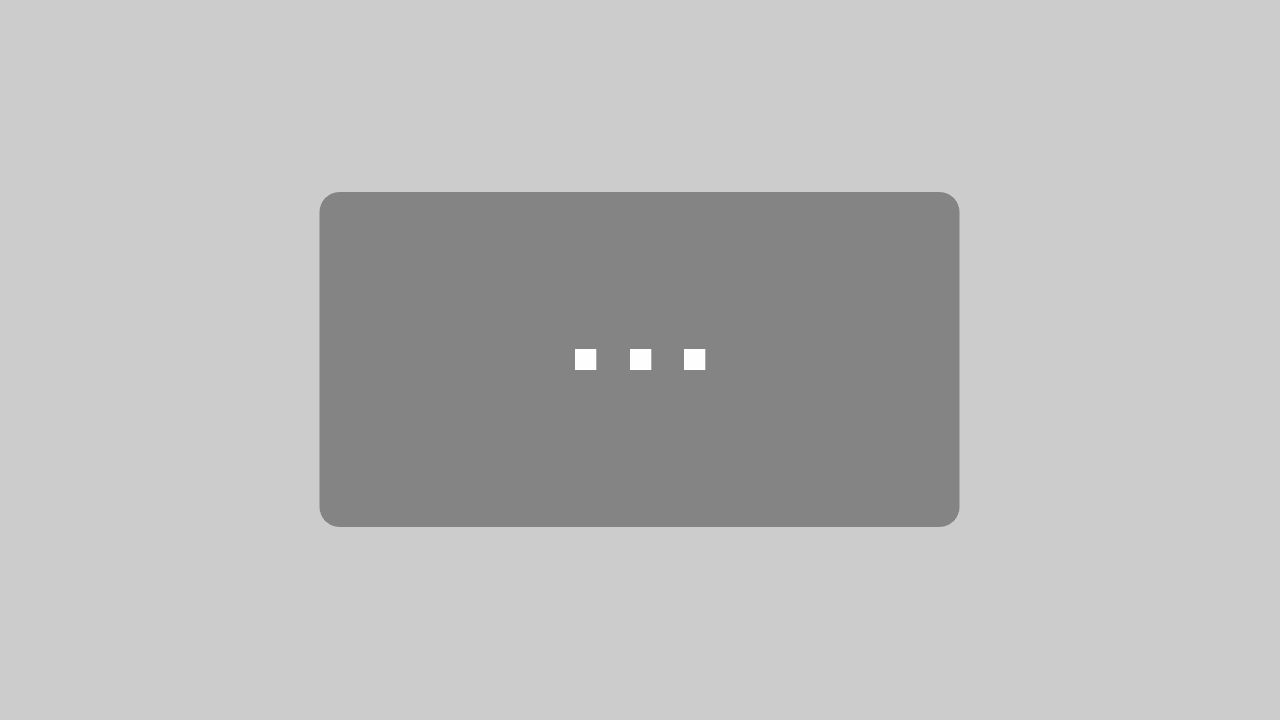







 u auf Europa in zehn Jahren.
u auf Europa in zehn Jahren.













