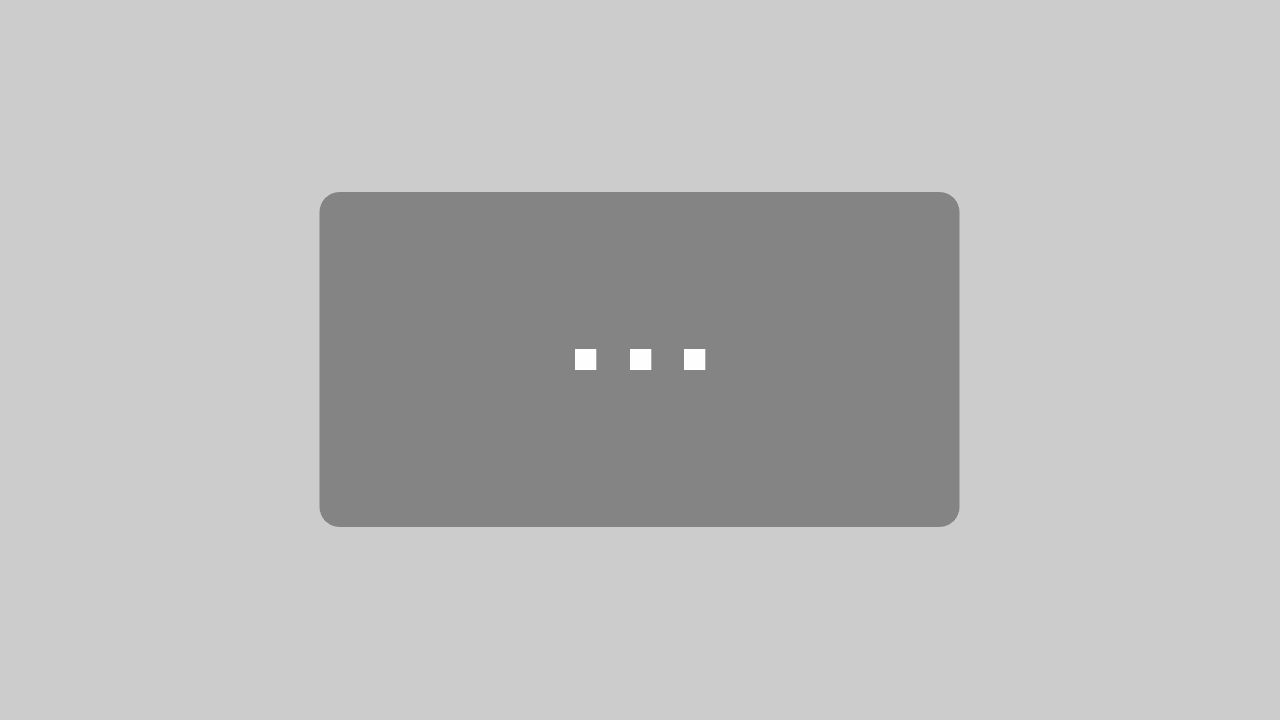„Wir Onliner machen womöglich einen anderen Journalismus, sind auch nicht immer Edelfedern, aber wir holen die Instrumente in die Redaktion um für alle Inhalte Reichweite zu schaffen.“ Und die braucht man. Instrumente, die heute Sinn machen, gibt es jede Menge. Vor wenigen Tagen ist der New York Times Innovation Report erschienen. Jens Nähler, Ressortleiter Online vom HNA, hat für den Input „Print online weiterdenken“ die Essenz rausgeholt und nennt ein Beispiel für guten Online-Journalismus nach dem anderen.
„Wir Onliner machen womöglich einen anderen Journalismus, sind auch nicht immer Edelfedern, aber wir holen die Instrumente in die Redaktion um für alle Inhalte Reichweite zu schaffen.“ Und die braucht man. Instrumente, die heute Sinn machen, gibt es jede Menge. Vor wenigen Tagen ist der New York Times Innovation Report erschienen. Jens Nähler, Ressortleiter Online vom HNA, hat für den Input „Print online weiterdenken“ die Essenz rausgeholt und nennt ein Beispiel für guten Online-Journalismus nach dem anderen.
-Zu der Präsentation von Nähler inkl. Links: Präsentation Jens Nähler_ Print online weiterdenken
Zuerst digital, und zwar zügig: Traditionen überdenken
Bei der New York Times kommt Online zuerst: „Digital First bedeutet, die bestmögliche digitale Berichterstattung zu produzieren ohne Rücksicht auf die Beschränkungen der Zeitung. Der letzte Schritt ist da, die vorhandene digitale Berichterstattung für die morgige Zeitung neu zu verpacken“, zitiert Nähler die Times und gibt ihr Recht. Er weißt auf Seiten wie Buzzfeed hin, deren Nachrichten auf Online-Dynamiken und Sozialen Medien basieren — und immer erfolgreicher werden. Redaktionen müssten Veröffentlichungswege und althergebrachte Print-Traditionen mal von Grund auf hinterfragen. „Man muss das, was man hat, auch einfach mal raushauen. Ergänzen kann man die Artikel später noch“.
Der Traffic kommt über Social Media
Social Media ist laut Nähler ein Schlüssel-Tool und sei eine bessere Werbung als eine gute Überschrift. „Man kann die Überschrift nicht 1:1 übernehmen, es muss persönlicher sein, emotionaler, wie ein Cliffhanger“. Heftig.co arbeite viel mit Cliffhangern. Kein Beispiel für tiefgründig recherchierten Qualitätsjournalismus, aber: Cliffhanger würden stark unterschätzt und seien gerade im Hinblick auf metered Paywalls ein wichtiges Mittel, damit die Leute weiterlesen. „Wir müssen mehr mit Cliffhangern arbeiten“, sagt Nähler. Wobei man die Wechselwirkungen, die eine Paywall mit Social-Media-Content haben, nicht unterschätzt werden sollten. „Wenn die Leute einmal nach einem geteilten Inhalt vor die Paywall rennen, teilen die deine Inhalte nie wieder.“ Und das ist wichtig, denn facebook und Co. sind diejenigen, die richtig Traffic erzeugen. Ein Inhalt, der über Social Media gut lief, habe auch auf der HNA-Website über Tage (und Tage sind für Online schon was) die besten Klickzahlen geschaffen. Also: Es reiche nicht, einfach die Artikel auf die Homepage zu stellen. Die Zugriffszahlen auf die Homepage würden stetig sinken. Da geht einfach keiner mehr direkt drauf. Stattdessen muss man die User über andere Kanäle auf die Seite kriegen. „Facebook Posts sind wichtig. Lernt, für Facebook zu posten!“, fordert Nähler auf. Upworthy habe vor einiger Zeit eine 50-seitige Präsentation öffentlich zugänglich gemacht, ein hochgradig spannendes Dokument, mit dem man sich dem Phänomen annähern könnte (bald in Linkliste). Wie?
Bestehendes einfach mal neu verpacken
Polarisieren. Neu verpacken. Das gilt für „das Lernen von der Konkurrenz“. Aus einem gut laufenden Artikel eines Konkurrenten habe ein News-Anbieter auf facebook einfach mal ein Quiz entwickelt. Das sei nicht nur richtig gut gelaufen, sondern könnte auch jeder kinderleicht selbst machen. Auch eigenen Content könnte man problemlos so aufwärmen, dass er schmeckt: Für Archive rät Nähler, viel mit Schlagworten zu arbeiten. Dann könnte man auch älteren Content „neu zusammenstellen, und zeitlos wieder hervorholen“. Zum Beispiel in Form eines Dossiers zum aktuellen Anlass. Die HNA gebe den Journalisten übrigens an die Hand, dass sie dafür verantwortlich seien, ihre Geschichten zu Promoten. Wo auch immer es geht, Facebook, Twitter, Google Plus, und vieles mehr.
Gute Multimedia-Reportagen müssen nicht teuer sein
Eine Erkenntnis aus dem Report der New York Times war auch, dass die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wie Marketing oder auch externen verstärkt werden müsse. Gerade wenn es um hochwertiges Storytelling a la Snow Fall von der New York Times, Firestorm vom Guardian, NSA Decoded vom Guardian oder die Augsburger Bombennacht von der Augsburger allgemeinen geht. Aber gute Reportagen müssen nicht teuer sein: Auch ein freies Wiki könnte mit jede Menge Dokumenten genutzt werden, um eine Geschichte zu erzählen, Material zusammenzustellen. Speziell für das moderne Storytelling hat der WDR vor ein paar Wochen das kostenlose Tool Pageflow entwickelt, mit dem man leicht Bilder, Texte und Videos in moderner Optik zu einer Scroll-Story zusammenfügen kann. Auch WordPress würde sich sehr gut eignen, Themen gut und günstig einen vorzeigbaren Webauftritt zu verschaffen. Selbst die Auseinandersetzung mit Big Data, was als ziemlich zeitintensiv gilt, kann man sich einfach machen. Im DataBlog liefert der Guardian regemäßig guten Datajournalismus. Mit tools wie Datawrapper ist das kostenlos möglich. „Datenjournalismus ist noch nicht ganz bei uns im Arbeitsalltag angekommen, aber das wird er, man kann damit spannende Geschichten machen“, sagt Nähler. Auch der Rechercheaufwand muss beim Storytelling nicht gleich astronomisch sein: Auf Berlinfolgen lässt die taz ganz normale Menschen aus ihrem Leben erzählen, optisch ansprechend mit großflächigen Fotos und Videos.
Ticker und Streams bieten Chancen
Ein weiteres interessantes Feld für Innovationen sei der Livestream. „Liveevents sind ganz großartige Mittel, um die Leserschaft abzuholen“, sagt Nähler. Er stellt auch ein sein eigenes Projekt vor kurz vor: Kassel Live. Ein anspruchsvoller und dennoch praktikabler Ticker in Form eines Zeitstrahls, in den Posts verschiedener Kanäle, Bilder, Texte und Videos eingepeist werden. Eine Tag Cloud ist auch dabei. Ist Nähler vollends zufrieden mit dem Projekt? „Die Ansprache ist vielfach noch ein Problem, noch zu nachrichtlich trocken, der Beitragsmix nicht bunt genug, es gibt noch einige Dinge, die wir verbessern wollen“. Eine Chance seien neben den Redakteuren, die den Ticker füttern, auch mobile Reporter. Die HNA mache mit Online übrigens kein Minus mehr. Die Diskussion über Bezahlmodelle sei aber noch nicht abgeschlossen.
Langfristig müsse es sich für Print/Online darum drehen, weg von einer Zeitung zu gehen, die Websites erstellt und hin zu einem Digitalunternehmen, das auch eine Zeitung produziert, so Nähler. Eine Redaktion könne nicht alle Kanäle bedienen und muss daher einschätzen, welchen Erfolg sie aus den verschiedenen Plattformen zieht. Und: „Wer Social Media gewinnt, gewinnt auch Mobil“. Wichtig sei es, so betont auch eine Teilnehmerin aus dem Plenum, im Kopf zu behalten: Die meisten User gehen heute davon aus, dass die guten Nachrichten sie finden. Nicht umgekehrt. Und das zu bewerkstelligen, ist eine Aufgabe, die nur im Team und mit einem strategischen Blick auf alle Kanäle bewerkstelligt werden kann.
 Welchen Einfluss EU-Politik auf seinen persönlichen Alltag hat, recherchiert Martin Tschepe für eine Reportage in der Stuttgarter Zeitung. Zudem findet der Redakteur im Landratsamt heraus, wo EU-Fördergelder in Städte und in den Landkreis fließen, stellt die Europaexperten der Kreisverwaltung vor und liefert ein „Kleines Wahl-Einmaleins“.
Welchen Einfluss EU-Politik auf seinen persönlichen Alltag hat, recherchiert Martin Tschepe für eine Reportage in der Stuttgarter Zeitung. Zudem findet der Redakteur im Landratsamt heraus, wo EU-Fördergelder in Städte und in den Landkreis fließen, stellt die Europaexperten der Kreisverwaltung vor und liefert ein „Kleines Wahl-Einmaleins“. „Die EU pumpt Millionen in den Landkreis“ – Gespräch mit der Europabeauftragen des Kreises über die EU-Fördergelder für lokale Projekte. –> Zum Online-Beitrag
„Die EU pumpt Millionen in den Landkreis“ – Gespräch mit der Europabeauftragen des Kreises über die EU-Fördergelder für lokale Projekte. –> Zum Online-Beitrag