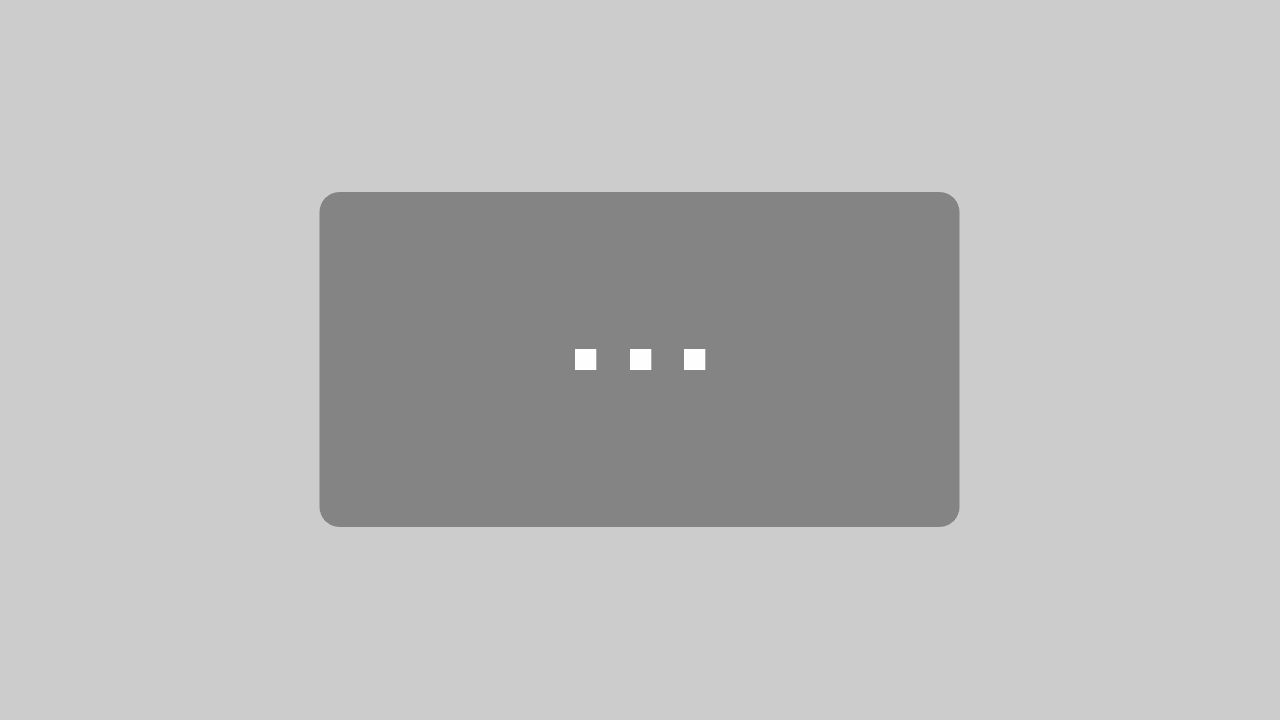Immer wieder berührt die Europapolitik die unmittelbare Lebenswelt der Menschen in der Region. Die Lokalredakteure der Madsack Heimatzeitungen zeigen dies in der laufenden Berichterstattung und holen die Europäische Union in den Alltag ihrer Leser. Einen Europaschwerpunkt im Lokalen haben sie mit der achtteiligen Serie „Sterne für Europa“ im Frühjahr 2010 gesetzt. Weiterlesen
Neueste Artikel
Aufgezeichnet – Graphic Recoording auf dem Forum Lokaljournalismus
Graphic Recording ist die visuelle Begleitung von Gruppenprozessen, Diskussionen oder Vorträgen. Ruth Rindlisbacher war visuelle Begleiterin auf dem 22. Forum Lokaljournalismus in Bayreuth. Mit ihr sprach Von Anke Vehmeier.
Wie funktioniert Graphic Recording?
Während die Teilnehmenden zuhören, verbinden diese ihre eigenen Bilder im Kopf mit einem vor ihren Augen in Echtzeit entstehenden „großen Bild“. Dadurch werden Inhalte und Zusammenhänge sichtbar und erlebbar gemacht. Meine Aufgabe ist das Hören, Spüren, Analysieren, dann Struktur geben und auf Papier festhalten. Und das alles möglichst schnell.
Wie entsteht das Bild?
Inhalt zuerst ist die Maxime – deshalb schreibe ich Schlagworte oder Originaltöne mit. Die Grafiken und Cluster entstehen dann auf dieser Basis. Zu großen Themenfeldern arbeite ich mich im Vorfeld natürlich ein.
Wenn Sie Ihr Bild beschreiben, was sagt es?
Es zeigt die ganze Vielfalt der Themen während der Diskussion: kontroverse Aussagen, Übereinstimmungen, offene Fragen, Analysen, Vorschau auf Bedürfnisse, Trends und Anregungen.
Wie ist es zu lesen?
Es liest sich von der Mitte ausgehend, im weiteren Verlauf themenmäßig andockend. In den jeweiligen Rahmen ist das Zusammengehörende erfasst. In diesem Falle ist jedoch das Wichtigste wirklich für jeden etwas anderes!
Was ist die zentrale Aussage?
Die zentrale Aussage ist sichtbar, in der Dynamik, wie ich sie empfunden habe: Die Diskutanten befinden sich auf einer „Drehscheibe“, es geht um Zusammenhalt; gerne und auch provokant miteinander diskutieren; den Tatsachen nicht ausweichen und in Bewegung bleiben. Wichtig ist auch der Schlusssatz eines Moderators (links über der Kamera) in der Sprechblase: „Wenn denn was hilft… nicht Larmoyanz“ (Ein Aufruf!).
Mehr Infos: www.aufzeichnen.at
Das Abschlusspodium … „Relevanz muss man sich leisten können“
„Welche gesellschaftspolitische Relevanz hat Lokaljournalismus heute?“ Diese Frage wurde auf dem Abschlusspodium des Forums diskutiert. Dabei waren Larissa Bieler, Chefredakteurin Bündner Tagblatt aus Chur in der Schweiz, Stefan Lutz, Chefredakteur des Südkuriers aus Konstanz, Michael Rümmele, Geschäftsführer des Nordbayerischen Kuriers, Professor Klaus Meier, Katholische Universität Eichstätt, Britta Bielefeld, Ressortleiterin Lokales beim Göttinger Tageblatt, und Svenja Prins, Happy Thinking People München. Moderatoren waren Joachim Braun, Chefredakteur des Nordbayerischen Kuriers, und der Unternehmensberater Prof. Klaus Kocks.
Wie relevant ist Lokaljournalismus heute?
Prof. Meier meinte, Verlage müssten eben gesellschaftspolitisch begründen, warum sie gebraucht werden. Profit alleine könne hierbei nicht das Argument sein. „Es wird in manchen Regionen in zehn oder fünfzehn Jahren keine Verlage mehr geben“, sagte er. Er hoffe, dass dann gesellschaftlich Wege gefunden würden, damit es weiterhin Lokalberichterstattung gebe.
Schlagabtausch zum Mindestlohn
Stefan Lutz meinte, dass der „Abkehrschwung“ bei den gedruckten Tageszeitungen anhalten werde. Es gehe aber um die Frage der Zahl der Kunden. Lutz meinte, Ministerin Ilse Aigner hätte am Vorabend den Verlagen beim Thema Mindestlohn den Rücken stärken können.
Dagegen wandte sich Michael Rümmele vom Nordbayerischen Kurier ganz entschieden. „Da schimpfen Leute über den Mindestlohn von Zeitungsausträgern, die noch nie um 2 Uhr morgens bei Schnee Zeitung ausgeliefert haben“, empörte er sich. Dafür erhielt er regen Applaus vom Publikum. Als „Verleger“ angesprochen, entgegnete Rümmele: „Ich bin kein Verleger, ich habe einen anständigen Beruf und bin Geschäftsführer.“
Konvergenz im Blick
Rümmele betonte, dass der Nordbayerische Kurier den Visionen seines Cheredakteurs folgen könne. Man komme nicht umhin, die Konvergenz zügig anzugehen. „Aber mal ehrlich: Viele Redakteure haben schon mit dem Schreiben ein Problem. Wir sollen die auch noch filmen?“
Larissa Bieler meinte, es werde viel gespart in den Redaktionen, gleichzeitig würden die Anforderungen ständig steigen. Aber gerade Journalisten mit lokaler Kompetenz würden gesucht. Sie betonte, die Offenheit gegenüber den neuen Kanälen sei durchaus vorhanden. Britta Bielefeld vom Göttinger Tageblatt sagte, dass ihre Redaktionen schon seit Jahren mit unterschiedlichen Kanälen, etwa mit Facebook und Twitter, arbeite. „Das machen auch alle gerne“, sagte sie. Diese Konvergenz sei selbstverständlich. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Menschen sich dafür interessieren, was die Zeitungen machen. Auch wenn die Auflagen leicht sinken würden – die Klickzahlen sprächen eine andere Sprache.
Was ist Relevanz?
Was hatte Wissenschaftlerin Prins dazu zu sagen? „Relevanz ist nicht fest zementiert“, meinte sie. Das Betonen der eigenen Relevanz sei schwierig in der heutigen Zeit. „Das Wort Relevanz verführt uns dazu, die Existenzberechtigung faktisch zu definieren.“ Der Leser entscheide selbst, was relevant sei. „Relevanz hat auch mit Lust und Motivation zu tun.“
Kocks meinte, dass sich unterschiedliche Dimensionen vermischen. „Reden wir über ökonomische Relevanz? Über publizistische Relevanz? Geht es um Online-Journalismus? Papier-Journalismus? Oder Papyrus-Journalismus?“
Wadenbeißer oder auf der Suche nach Harmonie?
Im weiteren Gesprächsverlauf ging es auch darum, wie hartnäckig und kritisch Lokaljournalismus sein soll. Meier sagte, bei Leserbefragungen komme immer heraus: „Wir wollen eine mutige Lokalzeitung. Aber auch eine faire. Niemand soll in die Pfanne gehauen werden.“ Manche würden zu sehr verurteilen, dass sei der falsche Weg.
Bieler betonte, dass sie beim Bündner Tagblatt keine „journalistische Aufgeregtheit“ anstrebten. „Brauchtum, Tradition, Kultur“ seien wichtig in ihrer Berichterstattung. Das heiße nicht, dass sie nicht auch Kontroversen austrügen, etwa auf der Seite 2 „Klartext“. „Ausgangspunkt ist es, eine Debatte zu entfalten.“ Lutz hob hervor, dass der Leser keine Bevormundung wünsche.
Rümmele betonte, dass das Geschäftsmodell Tageszeitung sich nicht mehr lohnen werde. „Gesellschaftliche Relevanz müssen sie sich leisten können.“ Hinzu komme eine „geistige Veränderung. Früher hat die Tageszeitung die Relevanz bestimmt. Da hat man nervende Leser mit 14 Tagen Aboentzug bestraft.“ Die Diskussion drehe sich im Kreise. Man müsse sich immer fragen, was die Menschen wollten. Auch Marktforschung bilde nur einen Ist-Zustand ab.
Lutz sprach von einer „Vollkaskoversicherung der Information“. Das sei ein unglaubliches „Produktversprechen“. Man dürfe sich auch nicht vor Unterhaltung scheuen. Wenn solche Inhalte nachgefragt würden, müsse man sich darum kümmern.
„Wir haben die Leute früher 20 Jahre zwangsbeglückt mit dem Abo“, sagte Rümmele. „Das ändert sich aber. Die Leser ändern sich. Natürlich brauchen wir noch gedruckte Exemplare. Aber wir leben davon, dass wir Informationen verkaufen. Auf welchen Kanälen ist mir egal.“
Prof. Meier schätzt, dass es auch in Zukunft Lokaljournalismus geben werde, aber in anderer Form, etwa als Blogs.
Lokaljournalismus im Dschungelcamp?
Sollen Lokalzeitungen auch über Boulevardthemen wie das Dschungelcamp berichten? „Bei acht Millionen Zuschauern verstehe ich die Frage gar nicht“, sagte Joachim Braun.
Prins meinte, man müsse untersuchen, was die Menschen wirklich an der Show interessiere. Bieler sagte, dass ihre Zeitung sich nicht nach solchen Trends richte. Es gehe auch um Kontinuität, zur Not auch darum, anachronistisch zu sein.
Am Ende blieben also doch auch Fragen offen: Kakerlaken-Shows statt Vereinsberichterstattung? Relevanz mit oder ohne Leser? Das Lokale geht weiter – aber keiner weiß wo? Wer Antworten sucht, ist eingeladen, wieder einmal bei der drehscheibe vorbeizuschauen. Die Debatte geht weiter.
Das Storify zum Forum Lokaljournalismus 2014
Götterdämmerung. Wir stehen vor dem Anbruch eines neuen Medienzeitalters mit ganz eigenen Konzepten, Innovationen und Trends im Spannungsdreieck von Lokaljournalismus, Politik und Gesellschaft. Wie gestalten wir es mit? Darum ging es beim 22. Forum Lokaljournalismus 2014 der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb vom 29. bis 31. Januar 2014 in Bayreuth.
Die Veranstaltung verstand sich als exklusive „Vordenker-Plattform“ für den Lokaljournalismus in deutschen und deutschsprachigen Medienhäusern. Es ging darum, die Ideen der kreativsten Köpfe der Branche zu bündeln und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und zu kommunizieren. Denn am Ende des Tages haben alle dasselbe Ziel: das sichere Bestehen des Lokaljournalismus.
Was auf dem 22. Forum Lokaljournalismus in Bayreuth getwittert, fotografiert und geblogt wurde, haben wir in einem Storify zusammengefasst.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von storify.com zu laden.
„Runter vom Sockel“ – Praxisgespräch 5
Wie schaffen wir es eigentlich, dass wir das, was wir unter Qualität verstehen, im gesamten Verlag durchbringen können?
Mit dieser Frage eröffneten Jana Klameth, stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse aus Chemnitz, und Ralf Freitag, Leiter Medien und Kommunikation in der Lippischen Landeszeitung, das Praxisgespräch „Qualitätsmanagement und redaktionelles Marketing – auf den Plan kommt es an“.
Mehr Qualität mit Themenmatrix und Storyplanner
Freitag zeigte eingangs gleich zwei Werkzeuge, um die Zeitung besser zu machen: die Themenmatrix und den Storyplanner. Bei der Themenmatrix geht es darum, dass die Redaktion festlegt, welche Geschichten auf welche Weise unbedingt in den kommenden Wochen ins Blatt müssen. Beim Storyplanner schreibt der Redakteur ein Konzept – was will ich mit dem Beitrag eigentlich erreichen? „Manche Journalisten sind Edelfedern, aber chaotische Rechercheure“, sagte Freitag. Storyplanner hilft deshalb vor allem bei zeit- und kostenintensiven Geschichten. „Das Formular schreckt erstmal ab“, meinte Roland Freund von der dpa. Spannend fände er jedoch das Reporterbriefing. „Wir haben gemerkt, dass wir in der Vergangenheit viel zu wenig wert darauf gelegt haben.“ Das könne aber sehr hilfreich sein, um den Fokus zu schärfen.
Die drei zentralen Diskussionspunkte waren:
1. Keine Zeitung „aus der Streichholzschachtel“
Manche Kollegen waren erst mal skeptisch. „So eine Themenmatrix haben wir schon Anfang der 90er Jahre gemacht. Das hat aber keine Veränderungen mit sich gebracht“, erzählte Anton Saarländer von der Main-Post und verschränkte die Arme vor der Brust. „Ich glaube nicht, dass man diese Tools braucht“, sagte Hans Willms von der Kreiszeitung. „Wir sind ja nicht in der Planwirtschaft!“ Zu verkopft, sagte einer. Ein anderer nahm die Themenmatrix in Schutz: „Die Idee von Kollege Freitag ist, zuerst ein Gerüst aufzustellen, an das man sich nicht haargenau halten muss. Wir wollen ja keine Zeitung aus der Streichholzschachtel.“ Holger Hartwig vom Pinneberger Tageblatt fand die Tools sinnvoll, aber sie würden nicht die Kernaufgabe lösen – mitzubekommen, was die Leute wollen. „Ein großes Problem ist, dass unsere Redakteure nicht mehr beim Feuerwehrverein sind oder am Fußballfeld. Vor allem Lokalredakteure bekommen ihre Geschichten ja von ihrem sozialen Umfeld.“
2. Wichtig: Mehr nach draußen gehen
Denni Klein von der Sächsischen Zeitung wusste genau, wo die Leser zum Lesen aufhören. Seit 2009 gibt es einen Readerscan im Haus. Mit einem Scanstift können Leser markieren, wann sie beispielsweise aufhören zu lesen. „Ein Ziel ist es, dadurch in der Live-Produktion mitzubekommen, was der Leser will – wie kann man das Thema auf- und ausbauen?“ Eine wichtige Erkenntnis aus der Leseranalyse war laut Klameth, dass es für die Leser viel spannender sei, Geschichten weiterzuverfolgen. Überhaupt, ist man sich einig, soll man mehr auf seine Leser hören. „Runter vom Sockel, auf Augenhöhe – das ist die Zukunft“, sagt Klamet. „Ziel für 2014 ist, wieder mehr nach draußen zu gehen“, sagte Ulrike van Weelden vom Main-Echo. Eine Kollegin von der Frankenpost erzählte von den guten Erfahrungen mit dem 12-köpfigen Leserbeirat. „Wir arbeiten kundenorientiert, deshalb müssen wir dem Leser auch zuhören.“ Auch die Redakteure von der Main-Post waren von der Idee der Medienombudsleute überzeugt: „Die sollten eine Beschwerdestelle sein, aber auch vermitteln, was wir hier machen.“ Soziale Medien als Rücklaufkanal für Feedback waren kein Thema.
3. Journalisten sollen in Produkten denken
Kurz vor dem Ende landete man dann doch wieder bei Freitags Eingangsfrage: Wie argumentiert man Qualität im Verlag? Auch da hat Denni Klein eine Antwort: „Man sollte Journalisten, Verleger und Marketingexperten an einen Tisch setzen. Journalisten sollen schließlich auch in Produkten denken – aber das haben die ja nie gelernt.“ Er fordert ein Ende der Abo-Prämien. Man solle besser Inhalte bewerben und Kooperationen mit anderen Lokalzeitungen eingehen. Die Freie Presse und die Sächsische Zeitung würden schon kooperieren, erzählte Klameth: Im Blatt hatten sie zum Beispiel einen Krankenhausführer mit einer „riesigen Patientenbefragung“, gemeinsam von beiden Zeitungen erarbeitet. Sich als Zeitung unentbehrlich zu machen – auch das geht nur mit Qualität.
Freiheit schafft Motivation – Praxisgespräch 4
Wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter motiviert arbeiten? Wie kann ich mich und meine Redaktion neu erfinden und aus der klassischen Vereinsberichterstattung ausbrechen? 50 Prozent der Journalisten würden sich laut einer aktuellen Studie nicht für den Leser interessieren, sagte Maike Sophie Wessolowski, Leiterin der Lokalredaktion Dillenburg des Herborner Tageblatts. Angeregt und angereichert mit vielen Erfahrungen aus Redaktionen aus ganz Deutschland haben Redakteurinnen und Redakteure über das Problem der „unkreativen Frösche“ unter ihnen diskutiert.
Die Lokaljournalisten haben gemeinsame Lösungsansätze gesucht und sind auf fünf Thesen gekommen:
1. Freiheit schafft Motivation
Die Freiheit als junger Journalist etwas Neues ausprobieren zu dürfen, aus den alten Strukturen auszubrechen und nicht nur nach dem Terminjournalismus zu arbeiten: „Was fehlt ist, dass die Leute einfach mal laufen gelassen werden.“ Dies war ein Grundgedanke, dem viele Teilnehmer der Gesprächsrunden zugestimmt haben. Besonders auch die freien Mitarbeiter müssten geschult werden. Dazu gehöre auch, dass sie nicht nur die „Drecksarbeit“ zu erledigen haben.
2. Kommunikation innerhalb der Redaktion ist extrem wichtig
Ein Koordinatensystem: Die eine Achse steht für Relevanz, die andere für Spannung. Die Redaktionsmitglieder ordnen ihre Themenvorschläge nach diesen Kriterien ein. Schneidet ein Thema eher schlecht ab, wird über Möglichkeiten nachgedacht, damit das Thema die beiden Kriterien erfüllt. Das System ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie durch gezielte Kommunikation in den Redaktionen das Format aufgewertet werden kann. Angeführt wurden zudem Checklisten, regelmäßige Treffen, um Themen zu planen und zu sammeln und eine ehrliche Blattkritik.
3. „Bekloppte Leute“ sind gefragt
„Die Mitarbeiter müssen innerlich brennen.“ Sie müssen auch mal auf verrückte Themen kommen und einfach neugierig durch die Stadt gehen; interessiert hinter geschlossene Türen blicken – wichtige Anforderungen, auch an Lokaljournalisten.
4. Wenn ich dem Leser etwas nehme, muss ich ihm dafür etwas Neues geben
Stichwort: Vereinsberichterstattung – Die typischen Orgelpfeifenbilder und ein chronologisch verfasster Bericht über die Jahreshauptversammlung werden an die Lokalredaktionen weitergeleitet. Was kann daran verändert werden, ohne dem Leser das Gefühl zu geben, ihm etwas wegzunehmen? Hintergrundgeschichten, Interviews und Reportagen, die das Zusammenleben in den Dörfern widerspiegeln oder eine regelmäßig erscheinende Sonderausgabe mit den klassischen Vereinsberichten sind zwei der vorgestellten Lösungsansätze. Wichtig sei vor allem der Austausch mit den Vereinen. Auch diese müssten begreifen, dass mit innovativen Formen der Berichterstattung mehr Leser gewinnen und damit auch mehr Aufmerksamkeit generiert werden kann.
5. Leserbindung
Soziale Netzwerke, Leserstammtische und –anwälte: Der Leser muss an seine Zeitung gebunden werden und sich ernst genommen fühlen. Er soll verstehen, warum über die Jahreshauptversammlung der Kaninchenzüchter nicht zum zehnten Mal auf gewohnte Weise berichtet wird. Deshalb sei es wichtig, den Kontakt mit den Zeitungskonsumenten zu suchen und sich mit ihnen auszutauschen.
Relevanz und Augenhöhe – Praxisgespräch 2
Das Podium von Herrn Praetorius hallte noch nach. Lassen sich seine Modelle überhaupt in Lokalzeitungen umsetzen? Und wenn ja, was bedeutet es für die Zeitungen? Das war eine der Fragen der Praxis-Gesprächsgruppe 2 „Relevanz und Augenhöhe – Inhalte für lokale User“. Moderiert wurde die Runde von Lutz Feierabend, stellv. Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers, und Nicole Amolsch, leitende Redakteurin der Heilbronner Stimme.
Was fragen Leser und User nach?
Lutz Feierabend präsentierte zunächst Grafiken zur Nutzung des digitalen Angebots des Kölner Stadt-Anzeigers. Die meisten Klicks gibt es demnach um 8/9 Uhr und um 12 Uhr. Bei der Nutzung über mobile Endgeräte seien die Kernzeiten morgens zwischen 5 und 7 Uhr, sowie abends ab 21 Uhr. Auch beim Kölner Stadt-Anzeiger könne man steigende Zugriffszahlen über mobile Endgeräte verzeichnen, sagte Feierabend.
Bei der Nutzung mobiler Apps gab es dennoch sehr unterschiedliche Erfahrungen, wie Publikumsmeldungen zeigten. Moderatorin Nicole Amolsch von der Heilbronner Stimme etwa sagte, die App ihrer Zeitung würde selten genutzt, weil die Leser schon die Onlineseite der Zeitung nutzen würden und damit zufrieden seien.
Jörg-Peter Rau vom Südkurier sagte, dass die App seiner Zeitung vor allem am Wochenende genutzt würde. Er konnte dabei feststellen, dass User, die von mobilen Endgeräten kommen, nur einen Artikel lesen, aber nicht länger auf der Seite verweilen. Eine Beobachtung, die auch Nicole Amolsch von der Heilbronner Stimme teilte. Auch sie sagte, dass viele Nutzer nur kurz auf die Homepage klicken, aber nie bis zu den hinteren Seiten durchklicken.
Was die Umstellung für die Redaktionsorganisation bedeutet? Die Entwicklung der Newsrooms und die Einführung von Frühschichten sei die größte Umstrukturierung in seiner Redaktion gewesen, sagte Lutz Feierabend. Besonders die Erkenntnis, dass Online-Nachrichten auch in den Abendstunden nachgefragt werden, sie dabei die größte Überraschung und Herausforderung gewesen.
Was bedeutet das für die Themenauswahl?
Frank Nipkau vom Zeitungsverlag Waiblingen sagte, er sei erschrocken darüber, welche Artikel am häufigsten gelesen werden. Auch er sieht die Entwicklung, dass vor allem „Blut“-Themen geklickt werden, also Unfallmeldungen, Einbrüche, Brände, gefolgt von Partymeldungen. Erst dann kämen die gut recherchierten Themen, die zwar in der Zeitung gut laufen, online aber kaum nachgefragt würden. Nipkau nennt das „Brände-betriebenen“ Journalismus. Dennoch würde dies keine endgültigen Schlüsse zulassen. So sei die erfolgreichste Ausgabe seiner Zeitung eine Weihnachtsausgabe gegeben – eine Ausgabe, aus der fast alle Sport- und Gewaltmeldungen herausgenommen wurden.
Frank Werner von der DeWeZet stellte die Frage, wie man auch unabhängig von Apps journalistischen Mehrwert schaffen könne. Gute Erfahrungen habe seine Zeitung mit der Digitalisierung des Archivs gemacht. So habe man auch ältere – wenig netaffine – Leser gewinnen können, die Interesse an historischen Themen haben. Zudem biete die Redaktion spezielle Schulungen für internet-interessierte, ältere Bürger an.
Greifen Lokalredaktionen bei der Themenauswahl auch auf lokale Blogs zurück, wollte Feierabend von den Teilnehmern wissen. Ja, sagte Britta Bielefeld vom Göttinger Tageblatt, dies sei selbstverständlich. Philipp Ostrop von den Ruhr Nachrichten hingegen sagte, dass ihn die meisten Nachrichten über twitter erreichen würden – er also gar nicht strukturiert lokale Blogs durchscannen müsse.
Amolsch verwies auf eine Studie, der zufolge die Verlässlichkeit von Quellen für die User eine untergeordnete Rolle spiele. Als bedeutendste Wissensquelle würden die meisten Befragten demnach Wikipedia wahrnehmen. „Spielen wir als Zeitung dann überhaupt noch eine Rolle“, fragte sie. „Die Leute wollen lieber eine gute, als eine wahre Geschichte lesen“, sagte dazu auch Rau vom Südkurier.
Lässt sich ein Fazit ziehen? Man müsse nicht nur zwischen Print und Online unterscheiden, sondern auch genau überlegen, welche Geschichte auf welchen Kanal verbreitet wird, sagte ein Teilnehmer.
Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte
Auch im zweiten Teil der Gesprächsrunde, am Nachmittag, war die Verlässlichkeit von Quellen eines der Themen. Wiebke Möhring etwa sagte: „Die Leute suchen nicht direkt nach verlässlichen Quellen. Sie suchen eine Nachricht. Und wenn eine entsprechende Zeitung unter den ersten Treffern bei google ist, dann gehen die User halt dahin.“ Harald Klipp vom Ostholsteiner Anzeiger und Sarah Hinney von den Weinheimer Nachrichten widersprachen. Beide sagten, dass Leser sehr wohl direkt auf die Zeitung zurückgreifen, um Neuigkeiten zu erfahren, und gegebenenfalls sogar Fragen an die Redaktion stellen würden. „Das Vertrauen in die Lokalzeitung ist da. Wichtig ist, dass wir es nicht verspielen“, sagte Hinney.
„Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, unabhängig vom Ort“, sagte Christian Lindner von der Rhein-Zeitung. Oftmals habe seine Zeitung „starke emotionale Geschichten“ aus kleinen Ortschaften nicht nur auf die regionale Onlineseite, sondern sogar auf die Gesamt-Startseite der Zeitung gestellt. Auf die Frage, ob Themen wie das „Dschungelcamp“ in der Online-Berichterstattung seiner Zeitung eine Rolle spielen, verneinte Lindner. „Wir befassen uns mit den wirklich regionalen Themen, alles andere, was andere Anbieter auch machen, findet bei uns nicht statt.“ Auch Uwe Renners von den Westfälischen Nachrichten sagte, er verzichte auf alles, was keinen regionalen Bezug hat.
Jens Nähler von der HNA widersprach. Sendungen wie das „Dschungelcamp“ und „Wetten dass“ seien sehr wohl lokale Themen – einfach weil sie von Lesern aus der Region geguckt werden.