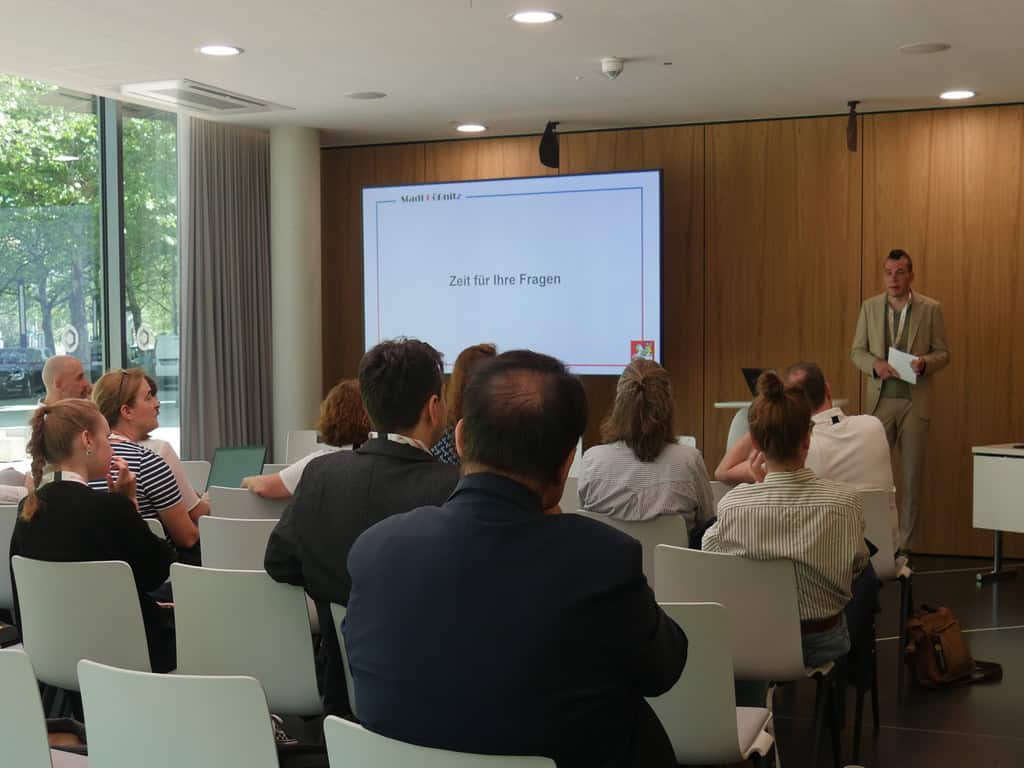Patrick Albrecht ist Bürgermeister von Gößnitz in Thüringen. (Foto: drehscheibe/Markus Klose)
Medien prägen Ansichten über wichtige Themen wie das Sicherheitsgefühl oder das Vertrauen in die Demokratie. Darin liegt eine Chance, wie das Praxisgespräch 5 auf dem Forum Lokaljournalismus 2025 zeigte. Der Titel lautete: „Mit Demokratie Relevanz beweisen, Vertrauen gewinnen, Quote machen“.
Lea Thies, Leiterin der Günter Holland Journalistenschule (Augsburg), stellte das „Voloband der Demokratie“ vor, ein Projekt mit ernstem Hintergrund: Im Februar 2024 belagerten wütende Landwirte das Druckhaus der Augsburger Allgemeinen. Sie wollten die Produktion verhindern. Trotz der angespannten Lage lud die Redaktion die Protestierenden zum Gespräch ein. Diese warfen der Zeitung vor, ihre Anliegen zu ignorieren. Zwar ließ sich der Vorwurf entkräften, doch das Treffen offenbarte ein Problem: Die Menschen waren über Telegram mit Falschnachrichten aufgestachelt worden.
Das Ereignis wurde zum Ausgangspunkt für eine Initiative der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung (Kempten), der Main-Post (Würzburg) und des Verlags Nürnberger Presse: das Voloband der Demokratie. Die Verlage bildeten ihre Volontärinnen und Volontäre zu Botschaftern für Medienkompetenz aus. In Workshops setzten sie sich mit Pressefreiheit, Mediennutzung und Didaktik auseinander und entwickelten Konzepte, um diese Themen Schulklassen zu vermitteln. in jedem Verlag koordinierte eine Ansprechperson das Projekt.
Big Tech-Plattformen gefährden mit Desinformationen die Demokratie – Lokalredaktionen steuern gegen
Die Nachfrage an Schulen sei riesig, berichtete Thies. Auch motiviere das Engagement den journalistischen Nachwuchs. Wirtschaftlich lohne sich das Projekt kaum. Thies wies auf ein Dilemma hin: Während Big Tech-Plattformen Demokratien gefährden, engagieren sich lokale Medien gegen Desinformation, oft entgegen ihrer wirtschaftlichen Logik. Aber lässt sich der Wert des Lokaljournalismus in Zeiten wie diesen mit Abonnement-Abschlüssen und Reichweiten bemessen? Braucht es vielleicht neue Parameter? Darüber wurde diskutiert. Trotz anfänglicher Skepsis herrschte am Ende Konsens: Stabile Finanzen sind überlebenswichtig – genauso wie gesellschaftliche Relevanz. Wenn Menschen merkten, dass Medien sie durch schwierige Zeiten begleiten, schaffe das Vertrauen. Auch das sei eine wertvolle Währung.
Dass Engagement goutiert wird, erlebte auch Dr. Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadt-Anzeigers. Nach der Correctiv-Recherche über rechtsextreme „Remigrationspläne“ initiierte ihre Redaktion die Aktion „Köln steht auf“. In verschiedenen Formaten wurde das Thema Zusammenhalt aufgegriffen. Es erschienen Sonderausgaben, etwa über das Grundgesetz. Eine Serie veröffentlichte einen Briefwechsel zwischen dem Direktor des NS-Dokumentationszentrums Köln und dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald. Die Redaktion porträtierte Ehrenamtliche und kommentierte regelmäßig positive politische Entwicklungen, ergänzt durch zahlreiche Live-Veranstaltungen. Gesellschaftliche Debatten anzustoßen und zu moderieren, sei ein Qualitätsmerkmal des Lokaljournalismus, sagte Brasack. Die Aktion habe die Zivilgesellschaft sichtbar gemacht und sich zudem positiv auf die Leser-Blatt-Bindung ausgewirkt.
Lokaljournalismus stärkt die Demokratie und ihre Werte
Lea Thies äußerte die Hoffnung, dass vielerorts Initiativen für die Demokratie entstünden, und regte mehr Erfahrungsaustausch an. Dazu trugen zwei weitere Gäste bei: Patrick Albrecht ist mit erst 24 Jahren Bürgermeister von Gößnitz in Thüringen. Seine Kandidatur verhinderte die Besetzung des Postens mit einer Person vom politischen Rand. Sein 3500-Seelen-Ort kämpft mit Unterfinanzierung und Geburtenrückgang. Albrecht begegnete dem Frust mit Bürgernähe: Er eröffnete einen Chat-Kanal und erklärt dort politische Prozesse, um Verständnis zu schaffen.
Robert Großpietsch, Leiter des Projekts „Im Sport verein(t) für Demokratie“, zeigte, wie der sächsische Landessportbund mit Extremismus umgeht und Prävention betreibt. Großpietsch brachte ein Positivbeispiel für die Verschränkung von Medien und Zivilgesellschaft mit: Als die B-Jugend eines Vereins kollektiv den Hitlergruß zeigte, schafften lokale Medien Öffentlichkeit. Sie begleiteten auch die Aufarbeitung des Falls.