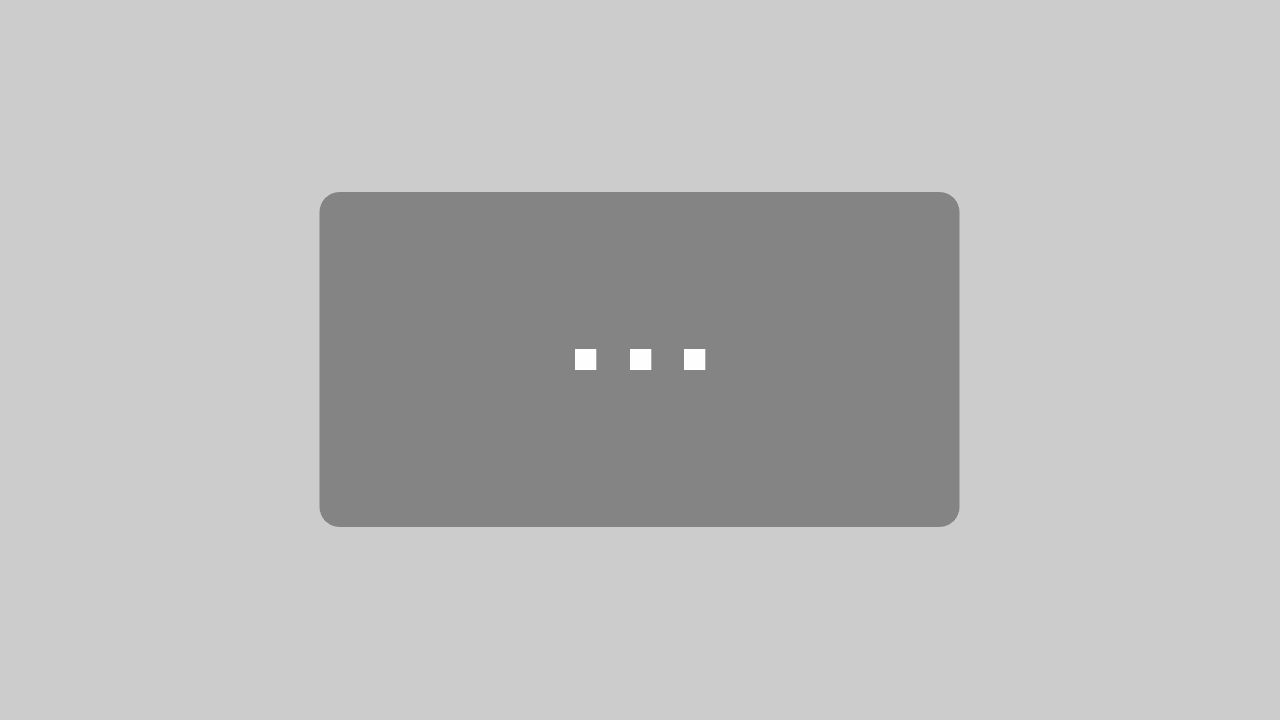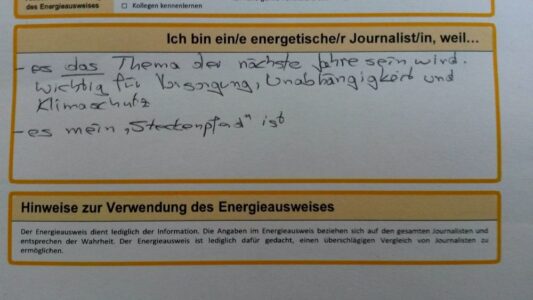„06.00 Uhr. Aus den Lautsprechern des Nachttischs erklingt leise Mozarts kleine Nachtmusik. Die Melodie schleicht sich in Jan Janssens Träume, während das Schlafzimmer langsam in rötliches, dann in helleres Licht getaucht wird. Jan hat die Zimmerdecke mit einer
hauchdünnen Schicht organischer Leuchtdioden überziehen lassen, die ihm pünktlich zur Weckzeit einen gefühlten Sonnenaufgang bescheren…“ Heute Abend las Kirstin Hengelage, Konzernkommunikationreferentin bei EWE Aktiengesellschaft, aus ihrem Buch „Next Energy: Erzählungen aus der Zukunft“ vor. Es sind Erzählungen über eine ganz normale, fiktive norddeutsche Familie Janssen im Jahr 2015. Hengelage hat die Szenarien zusammen mit Wissenschaftlern erarbeitet – beziehungsweise die Wissenschaftler zusammen mit ihr. „Die Idee der Geschichte war, eine Situation zu zeigen, in der für die Probleme der Energiewende eine Lösung gefunden wurde. Jeder von Ihnen wird sich daron selbst wiederfinden undein Bauchgefühl haben ob das möglich ist oder nicht“, sagte Hengelage.
Energiewende ganz lebensweltlich
Und deswegen ist es auch für Journalisten interessant: Das Buch bricht Szenarien der Energiewende bis auf die eigene Lebenswelt herunter. Eine Grundvoraussetzung für klassische politische Meinungsbildung, wie Lokaljournalisten sie anstoßen können. „Das bringt einen zum Nachdenken; die Tatsache, dass man sich aus einer anderen Perspektive selbst Gedanken über diese Dinge macht, und was man davon hält.“
Eine weitere Szene gefällig? „Jans Blick fällt auf die im Spiegel eingeblendeten Wetterdaten. Wie selbstverständlich stehen sie dort zur Verfügung, frisch eingespielt aus dem Internet, ebenso wie sein privater Terminkalender für heute. Aktiviert wird der Spiegel über den Bewegungsmelder, der beim Betreten des Badezimmers auch für Licht sorgt. Die Wettervorhersage meldet Sonnenschein, den ganzen Tag!…. Um sich wie gewohnt beim Rasieren die aktuelle Energieversorgung des Hauses anzeigen zu lassen, tippt Jan mit dem Finger auf das Spiegeldisplay. Es erscheint eine einfache Grafik aus zwei Kurven: Eine Kurve steigt sichtbar an – sie stellt den aktuellen Stromverbrauch des Hauses dar. Die zweite Kurve zeigt, wie viel Strom die Photovoltaikanlage aktuell produziert…. Ihr Stromanschluss ans öffentliche Netz ist keine Einbahnstraße – zeitweise beziehen sie Strom daraus, zu anderen Zeiten speisen sie Strom ein. Jan und Hanna halten ihre Stromkosten niedrig, indem sie ihren Energieverbrauch möglichst passgenau an die jeweilige Situation im Stromnetz anpassen.“
Zukünftig wird es wichtig sein, die Spannung stabil zu halten – weniger darauf, direkt Energie zu sparen, denn das ist schon selbstverständlich, sagt Hengelage. „Es wir darauf ankommen, eine gewisse Höchstleitung im Haushalt nicht zu überschreiten. Denn dann sind Sie für den Netzbetreiber sehr gut kalkulierbar.“ Stromknappheit werde es nicht geben, sondern eher ein Verteilungsproblem. Reguliert durch Datenströme.
Alles denkt mit oder erzeugt Energie, Mobilitätsketten die Berührungslos mit den modernen Smartphones der Zukunft passiert werden können – in dieser Vision funktioniert alles über Daten, „Freiheit gegen Komfort und Bequemlichkeit“, fasst der Moderator Robert Domes zusammen.
Dieser Tausch hat heute schon angefangen. Aber bis wir an im Buchszenario ankommen, müsste noch eine Menge passieren. Hengelages Vision ist interessant. Aber ziemlich nett gemeintDas weiß auch Hengelage. „Die Energiebranche kämpft.“ Umsätze brachen ein, Mitatbeiter verloren ihre Arbeitskräfte. Früher wurde verbrauchsorientiert erzeugt. Heute stehe alles auf dem Kopf, der Verbrauch sei nicht mehr an die Erzeugung gebunden.
Freiheit gegen Komfort
Hengelages Aufgabe, ist es als Kommunikationsreferentin für die Mitarbeiter selbst einen Überblick zu schaffen, sie weiß über die neuesten Forschungsinnovationen Bescheid.
Greentostore ist einer der Forschungsbereiche – „sie nennen das Speicherwolke, ungenutzten Speicher entdecken und nutzbar machen“, sagte Hengelage. Zum Beispiel von Autos, die 14, 15 Stunden lang in der Garage stehen. Ein weiteres Thema sind „virtuelle Kraftwerke“, die entstehen, wenn man einzelne Anlagen wie eine Biogas- und eine Solaranlage miteinander
vernetzt und dafür sorgt, dass sie sich bedarsgerecht abstimmen.
Das ist sehr abstrakt. Wie sieht es mit Problemen aus, die viele betreffen? Offshore? Gasanlagen? „Aus Sicht eines Energieversorgers macht es auch an guten Windstandorten Sinn, sichere Erzeugungskapazitäten aufzubauen. Auch wenn es viel kostet. Auf dem Meer ist der Wind vergleichweise konstant.“
Doch diese Energie muss irgendwo hin. Wenn an der Küste zu viel Windenergie erzeugt wird, führe das oft zu „Energie-Rückstau“, sodass man die Windräder erstmal wieder abstellen müsse, berichtete Hengelage. „Je weiträumiger man etwas verteilen kann, desto einfacher wird es. Wenn sie alles vor ort produzieren, können Sie Überschüsse schlecht ausgleichen“, sagt sie. Ihrer Meinung nach ist die Energiewende dezentral. Ganz anders als andere Beiträge in dieser Woche.
Konflikte und Möglichkeiten gibt es genug
„Wir bauen eine komplette Energieversorgung auf, haben aber noch einen Energiepark. Das sind Kapitalkosten für Kapazitäten, die wir gar nicht brauchen“, sagte Hengelage. Das Geld umzulegen auf den Strompreis sei auch nicht die Lösung. „Irgendwann muss der eine Park den anderen ersetzen.“ Gaskraftwerke eignen sich zum Beispiel super, um erneuerbare Energien auszugleichen. Einfach steuerbar, zack zack. „Aber Gaskraftwerke sind momentan sehr unwirtschaftlich. Wir haben auch eines gebaut, und 38 Millionen damit abgeschrieben.“
Fragen über Fragen aus dem Plenum. Die Diskussion lief heiß. „Mir fehlt der Masterplan, die einen machen dies, die anderen das“, sagte ein Teilnehmer, und schien auszusprechen, was sich viele Leute im Plenum dachten.
In der Realität kann auf dem Weg der Energiewende viel schiefgehen. Vor allem müsse die Energiewende auch gesellschaftlich gedacht werden, sagt Hengelage. Es gibt viele Ungleichgewichte: Leute, die zu arm sind, um ihre Stromrechnung zu bezahlen. Menschen, die in Ländern leben, die den Klimawandel nicht verursacht haben, und dennoch unter den Folgen leiden. Und Länder, in denen die Energiewende kaum eine Rolle spielt.
„Vielleicht gibt es im nächsten Buch auch Tote“, sagte Hengelage trocken. Ein gespielt-empörtes Lachen ging durchs Plenum. Ein Lachen, das unangenehm ist, und zum Nachdenken anregt. Heute Abend wurden die großen Energiethemen unserer Zeit diskutiert. Für sich selbst und für die Leser. Eine schönes Szenario wäre es, wenn die Diskussion im Blatt weitergeht.