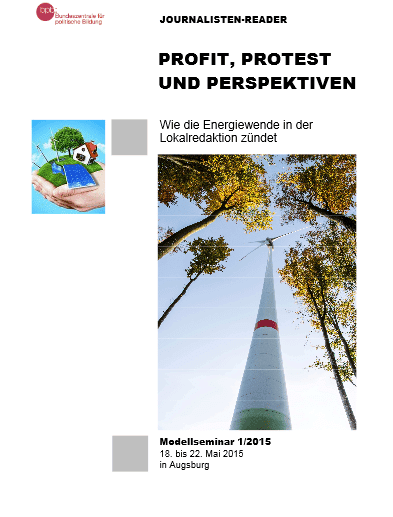Eine Woche lang harte Diskussionen, lange Abende, schweißtreibende Kämpfe mit dem WLAN – und nun ist es vollbracht. Die Konzepte, um die Energiewende aus vier verschiedenen Perspektiven begleiten und darstellen zu können, stehen. Mit viel Kreativität und Feuer stellten die Arbeitsgruppen sie vor.
Die gesamte Seminardokumentation mit den Arbeitsgruppenergebnissen erhalten Sie hier: Dokumentation Modellseminar Energiewende
AG 1
Wir haben Energie – die Bürgerinnen und Bürger mischen mit

„Leute, Redaktionskonferenz!“ Hopp hopp! Die fiktive Redaktion versammelt sich, der Zeitdruck sitzt ihr im Nacken. Was steht an? Es muss schnell gehen, die Blattkritik fällt heute aus. „Stromtrasse im Verbreitungsgebiet!“ wirft einer ein.
Unsicherheit bis Ablehnung beherrschen den Raum.
„Brauchen wir das überhaupt? Was geht uns das an, wenn die Bayern keinen Strom haben?
„Da bauen die in Schlewswig Holstein Windkraftanlagen und wir sollen darüber berichten?“
So kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein Konzept, stellt die fiktive Redaktionskonferenz fest. „Genau so etwas ist bei uns schon oft vorgekommen“, sagt einer der Teilnehmer. „Deswegen haben wir das sogenannte Perlach-Modell entwickelt.“
Das Perlach-Modell
Punkt 1: Sich einen Zugang verschaffen. Wer kann im Thema Energiewende involviert sein? Ein erster Schritt ist es, beim örtlichen Energieversorger anzurufen, beim Netzbetreiber, Verbraucherzentralen, Unis.
Stufe 2: Wenn klar ist, wo man in der Region, im Landkreis steht, geht es darum das Projekt konkret zu beleuchten. Schwierig und gleichzeitig fordernd an Energiewendeprojekten ist, dass man sich auch mit den gesetzlich Rahmenbedingungen auseinandersetzen muss. Also nicht nur: Wann kommt die Stromtrasse, wie sieht sie aus, sondern auch: Warum kommt sie, wie ist sie gesetzlich eingebettet und wie kam dieses Gesetz zustande? Der Bezug zur Energiewende als Großes und Ganzes ist auch ein wichtiger Schritt der Stufe.
Stufe 3: Akteure vorstellen. Jeder im System hat unterschiedliche Interessen. Politik, Wirtschaft, Bürger, ja, aber selbst diese Differenzierung reicht nicht, denn auch Bürgerinitiativen setzen unterschiedliche Schwerpunkte.
Stufe 4: Szenarien und Alternativen vorstellen. Was passiert wenn das Projekt kommt? Was passiert, wenn es nicht kommt? Was ist realitisch? Bei diesem Punkt sind ein roter Faden und Perspektiven am wichtigsten.
Stufe 5: Pro und Contra. Wie bewerten verschiedene Menschen diese Szenarien? Interviews, Gegenüberstellungen, und immer wieder auf Fakten hinweisen ist hier die Devise.
Stufe 6: Plattform schaffen. Spiegeln die, die am lautesten reden, die Mehrheit wieder? Und wie kann man man denjenigen, die benachteiligt sind, einen Zugang schaffen?
AG 2
Energie-Quellen richtig anzapfen
 Ein Tag im Leben eines Journalisten, der zur Energiewende recherchiert. Er sitzt am Computer, denkt sich nichts Böses – und plötzlich prasseln die Stimmen auf ihn ein. Sechs andere Journalisten laufen murmelnd im Kreis um ihn herum. Totale Überforderung.
Ein Tag im Leben eines Journalisten, der zur Energiewende recherchiert. Er sitzt am Computer, denkt sich nichts Böses – und plötzlich prasseln die Stimmen auf ihn ein. Sechs andere Journalisten laufen murmelnd im Kreis um ihn herum. Totale Überforderung.
„Halt!“
Und sie halten tatsächlich an. Doch jeder von ihnen sagt etwas anderes. Mit mehr oder weniger überzeugenden Argumenten.
Windenergie?
„Sinnvolle Investition, technisch fortgeschritten, ein super Standort ist das doch bei Ihnen.“
– „Das geht bei uns im Dorf gar nicht. Die verschandeln doch die Landschaft! Wir wollen doch eine Touristenregion werden, unsere Dächer sind so schön rot gedeckt!“
Biogas?
„Wenn das mit der Schweinegülle für die Biomasse nicht reicht, packen wir eben noch ein bisschen Mais dabei, der wächst ja auch überall!“
– „Ne, das geht bei uns im Dorf gar nicht.“
Zig mehr oder weniger überprüfbare Pro-Argumente gegen die Skepsis der Bürger, oft bleiben Journalisten genau an diesem Punkt hängen. „Vielleicht schreibe ich doch über das Schützenfest“, fragt sich der Journalist.
Doch die Rettung naht: Das Konzept der Arbeitsgruppe. Sie hat einen Glossar erarbeitet mit den Grundbegriffen der Energiewende und eine Liste mit praktischen Recherchequellen. Für einen klaren Kopf.
AG 3
Neue Energie – lohnt sich das?
 Eine typische Stammtischsituation, geselliges Beisammensein und lockeres Geplauder. Ein Radiospot unterbricht die Runde, es geht um eine Passivhaussiedlung in Augsburg. Die Gruppe steigt ein: Passivhaus? Wie könnte ich selbst sanieren? Was lohnt sich? Es geht von einem Thema aufs nächste, Subventionen, Leute die auf Erneuerbare Energien setzen, früher auf Traktoren fuhren und heute mit BMWs.
Eine typische Stammtischsituation, geselliges Beisammensein und lockeres Geplauder. Ein Radiospot unterbricht die Runde, es geht um eine Passivhaussiedlung in Augsburg. Die Gruppe steigt ein: Passivhaus? Wie könnte ich selbst sanieren? Was lohnt sich? Es geht von einem Thema aufs nächste, Subventionen, Leute die auf Erneuerbare Energien setzen, früher auf Traktoren fuhren und heute mit BMWs.
In der Dokumentation finden sich Vorschläge, wie man diese Themen in Serien verpacken kann. Welche finanziellen Auswirkungen die Energiewende auf die Region hat, und wie kann der Leser selbst am besten sparen.
AG 4
Mit Energie ins Netz!
 Die Arbeitsgruppe wollte ihr eigenes multimediales Energie-Projekt auf die Beine stellen und einen digitalen Werkzeugkoffer für die Praxis bauen, der in keiner Redaktion fehlen sollte. Diese Aufgabe haben sie gemeistert – mit Bravour.
Die Arbeitsgruppe wollte ihr eigenes multimediales Energie-Projekt auf die Beine stellen und einen digitalen Werkzeugkoffer für die Praxis bauen, der in keiner Redaktion fehlen sollte. Diese Aufgabe haben sie gemeistert – mit Bravour.
Die Seiten sprechen für sich:
Mit dem Storytelling-Tool Shorthand Social haben sie es möglich gemacht. Zu zwei Themen „Biogasanlage, die sich im Rat durchgesetzt hat und kommen wird“ sowie „Stromtrasse bzw. die Energiefresser“ haben sie ein fiktives Storytelling entwickelt. Sie fangen mit liebevoll selbst gedrehten Pro- und Kontra-Videostatements an, die durch Youtube-Embedcodes eingefügt wurden. Es geht mit einer Menge Tools weiter, die der Struktur halber immer wieder von Textbeiträgen durchbrochen wurden, darunter:
- Scribble Maps: Dieses Tool wurde dazu genutzt um die Anlage selbst sowie weitere Objekte mit Fotos einzuordnen. Für den Trassen-Beitrag haben sich die Karten sehr gut geeignet um den Trassenverlauf darzustellen und ebenfalls mit Bildern zu versehen.
- Infogram: Selbstgemachte Infografiken zum Maisanbau in Niedersachsen. Eine zweite Möglichkeit ist der Datawrapper.
- Thinglink: Einfach Bilder und komplexe Darstellungen mit Markierungen, Texten und Multimedia erklären.
- Soundcloud: einfach Audio-Beiträge abspielen, O-Töne, die schnell vor Ort aufgenommen wurden
- Klassische Bilder wurden unter anderem dafür genutzt,, Größenverhältnisse zu vergleichen und statische Grafiken einzubinden. Auch der gute alte Link um den Lesern den Zugang zu den Originalwuellen zu nutzen, sollte nicht unterschätzt werden
- JS Timeline: Gesamtplanung und Planungsstände einfach in einem Zeitstrahl darstellen
- Storify, um die Debatte in den Sozialen Medien einzubinden, oder auch Medien wie Videos und Fotos einzubinden
- Umfragetool von Shorthand Social, das Umfragen abwickelt und Grafiken erzeugt und sich in der Enddarstellung auch super für Print eignet
„Jedes von diesen Tools ist intuitiv zu bedienen. Es geht super schnell, und super einfach.“
Und so sind die Konzepte, die hier erarbeitet wurden, vor allem eins: Mutmacher für den Redaktionsalltag.