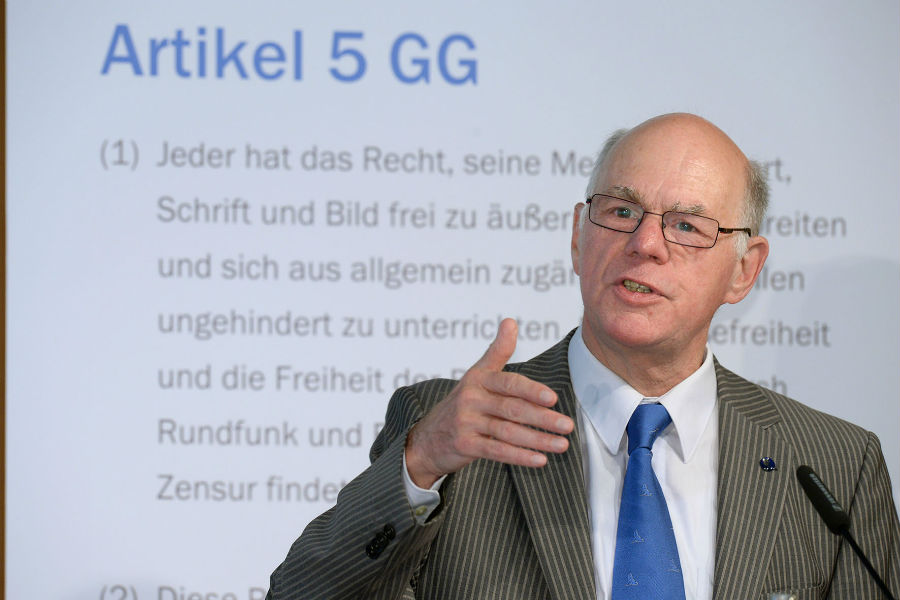„Die überwältigende Mehrheit stuft die Pressefreiheit als gut oder sehr gut verwirklicht ein“, beginnt Prof. Dr. Renate Köcher, Leiterin des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD), die Vorstellung der neuen IfD-Studie. Dann ist ja alles klar. Oder? Nein, so einfach ist es nicht. Wenn man genauer nachfragt kommt ans Tageslicht: Journalisten fühlen sich massiv unter Druck gesetzt. Vor allem von der wirtschaftlichen Situation, Zeitmangel, PR und digitaler Schnelligkeit.
„Die überwältigende Mehrheit stuft die Pressefreiheit als gut oder sehr gut verwirklicht ein“, beginnt Prof. Dr. Renate Köcher, Leiterin des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD), die Vorstellung der neuen IfD-Studie. Dann ist ja alles klar. Oder? Nein, so einfach ist es nicht. Wenn man genauer nachfragt kommt ans Tageslicht: Journalisten fühlen sich massiv unter Druck gesetzt. Vor allem von der wirtschaftlichen Situation, Zeitmangel, PR und digitaler Schnelligkeit.
Die Zusammenfassung der Studienergebnisse können Sie hier herunterladen: IfD_Einflussnahme auf Presse_Summary_3.6.
In der IfD-Studie „Pressefreiheit in Deutschland: Einflussnahmen von außen auf die journalistische Arbeit“ im Auftrag der Stiftervereinigung der Presse standen Lokal-, Wirtschafts-und Politikjournalistinnen und -journalisten im Mittelpunkt. Beziehungsweise: Ihre Wahrnehmung der Dinge. Wie frei ist die Presse in Deutschland wirklich? Fühlen sie sich am Gängelband gehalten? Die große Mehrheit der Journalisten habe Einflussversuche erlebt, besonders Lokaljournalisten – und da wiederum oft in den Bereichen Sport und Musik. Der Zugang zu bestimmten Akteuren würde immer stärker eingeschränkt und häufig nur über PR-Agenturen möglich gemacht. Informationen würden bewusst gelenkt und kanalisiert, die freie Berichterstattung erschwert. Es wurde auch frustrierenden Erfahrungen berichtet, die es „wohl immer geben wird“, so Köcher: Anfragen, die nicht hinreichend oder gar nicht beantworter werden, haben knapp 70% ab und zu oder häufiger erlebt. Antworten, die vor der Autorisierung eines Interviews stark verändert würden. Vor allem Unternehmen seien sehr an einer gewissen Selbstdarstellung und folglich Informationssteuerung interessiert – und würden versuchen, Recherche zu behindern oder in eine gewisse Richtung zu lenken. Aber auch das Geschäft mit dem Journalismus sei keine Seltenheit: „Jedem Fünften wurden Informationen im Gegenzug dazu angeboten, eine bestimmte Bewertung vorzunehmen.“ Ebenso Geschäfte und Unternehmen vor Ort, die viel zu verlieren haben, aber durch Öffentlichkeit auch viel gewinnen können, würden versuchen, Einfluss auf die lokaljournalistische Arbeit zu nehmen. Also: PR-Maßnahmen gehören für viele zu den alltäglichen Einflussversuchen.
Vor allem aber – und das hebt Köcher immer wieder hervor – sei jedoch der wirtschaftliche Druck ein Thema der Pressefreiheit. Speziell für den Lokaljournalismus. Die finanzielle Basis der Verlage würde als unzureichend wahrgenommen, und die Auswirkungen auf den Arbeitsalltag als gravierend. Die große Mehrheit der Lokaljournalisten habe das bereits erfahren. „Das größte aktuelle Risiko aus der Sicht der Journalisten ist die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Branche und auch der Zeitmangel“. Dies hänge häufig zusammen, sagt Köcher, und verweist auf zusammenschrumpfende Redaktionen. An zweiter Stelle bei der Frage nach den Gefährdungen der Pressefreiheit, hinter dem Zeitmangel, nennen die Journalisten, dass sie auf die wirtschaftlichen Interessen ihres Hauses Rücksicht nehmen müssen. Und die verschwindende Zeitungsvielfalt. Köcher stellt die These auf, dass die wirtschaftliche und zeitliche Druck andere Beeinflussungsversuche in der Wahrnehmung der Journalisten verstärken würde. Wer weniger Zeit, Kapazitäten und mehr Druck hat, hat auch weniger Zeit zum Nachfragen, reagiert empfindlicher auf PR. Annähernd 80% zogen die Bilanz, dass die Grenzen zwischen PR und Journalismus verschwimmen. Das wirke aber wiederum negativ auf die Journalisten zurück: Viele hätten Hemmungen, positiv über Unternehmen zu berichten, weil sie Angst haben, als PR-anfällig verdächtigt zu werden. Aber: „Versuche, die öffentliche Berichterstattung zu beeinflussen wird es immer geben, dafür ist sie einfach zu wichtig.“
Die Beschränkungen der Freiheit der Berichterstattung hätten in den letzten Jahren nach dem Eindruck vieler Journalisten eher zugenommen. Was kommt häufiger vor, was kommt seltener vor? Überraschend ist hier der Punkt, der wohl zurückgegangen wäre: Dass man durch Begünstigungen versucht, eine wohlwollende Berichterstattung zu bewirken. „Man sieht, dass die Compliance-Regelungen der deutschen Wirtschaft rigoros gehandhabt werden“, kommentiert Köcher.
Online-Medien machten auch einen großen Teil der Studie aus. Viele Journalisten befürchteten Ausspähung. Zudem würden die digitalen Möglichkeiten auch den Zeitdruck erhöhen. Aber wer schnell publizieren und alles auf alle Kanäle pusten muss, hat wenig Zeit zum Nachrecherchieren. „Eine wichtige Frage wird sein, ob man den gründlichen Journalismus in Zukunft verteidigen kann“, sagt Köcher.
Soziale Medien seien Chance und Herausforderung zugleich: Interessengruppen nutzen Soziale Medien zum Lancieren bestimmter Themen in der Öffentlichkeit. „Klassische Print und- Funkmedien schwächeln beim öffentlichen Agendasetting.“ Umgekehrt würden soziale Medien häufig für die Recherche genutzt – manchmal aber auch überbewertet. „Die Bewertung von Twitter ist immer größer als die faktische Nutzung“, sagt Köcher, und verweist auf Zahlen im knapp zweistelligen Bereich. Auch Cybermobbing sei heute ein Thema für Journalisten. „Das Feedback im Netz, das Journalisten heute haben, macht ihnen teilweise Angst. Die Tonalität in einem Shitstorm hat mit guter Kinderstube nichts mehr zu tun“, sagt Köcher.
Besonders spannend findet Köcher folgende Aussage eines Journalisten: „Zur Zeit findet eine Renaissance der Printmedien statt, sie werden neu anerkannt, als seriöser empfunden“, lautet dieses. Ein realistisches Szenario? „Ich glaube, dass es zu einem solchen Prozess kommen kann, aber bis dahin haben wir noch einen langen Weg vor uns“, sagt Köcher.
„42% denken, dass Journalisten heute stärker als früher gezwungen seien, wirtschaftliche Einschränkungen hinzunehmen“. Das Fazit für viele sei: Die wirtschaftliche Situation zwingt zu Kompromissen. Eine fatalistische Haltung. Was kann man denn tun, um die Pressefreiheit zu verteidigen? Wirtschaftliche Unabhängigkeit sicherstellen, aber auch: Mehr Souveränität und Selbstbewusstsein der Journalisten. Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus hängen eng zusammen. Köcher hat Hoffnung für den Printjournalismus, betont seine Wichtigkeit, und sieht auch den Staat in der Verantwortung, ihn wie Funkmedien zu „sichern und alimentieren“.
Ihre These: Print ist unverzichtbar.
 Sven Gösmann, dpa-Chefredakteur, greift die letzten Worte des Impulsreferats der SZ-Redakteurin Annette Ramelsberger auf: „Erstmal kapieren dann kommentieren, denn Journalismus ist schließlich mehr als ein Newsroom.“ Es gehe immer noch darum, anzurufen, hinzufahren, Journalisten dazu in die Lage versetzen. Denn die Ideenkrise sei ein Teil der ökonomischen Krise des deutschen Journalismus.
Sven Gösmann, dpa-Chefredakteur, greift die letzten Worte des Impulsreferats der SZ-Redakteurin Annette Ramelsberger auf: „Erstmal kapieren dann kommentieren, denn Journalismus ist schließlich mehr als ein Newsroom.“ Es gehe immer noch darum, anzurufen, hinzufahren, Journalisten dazu in die Lage versetzen. Denn die Ideenkrise sei ein Teil der ökonomischen Krise des deutschen Journalismus.