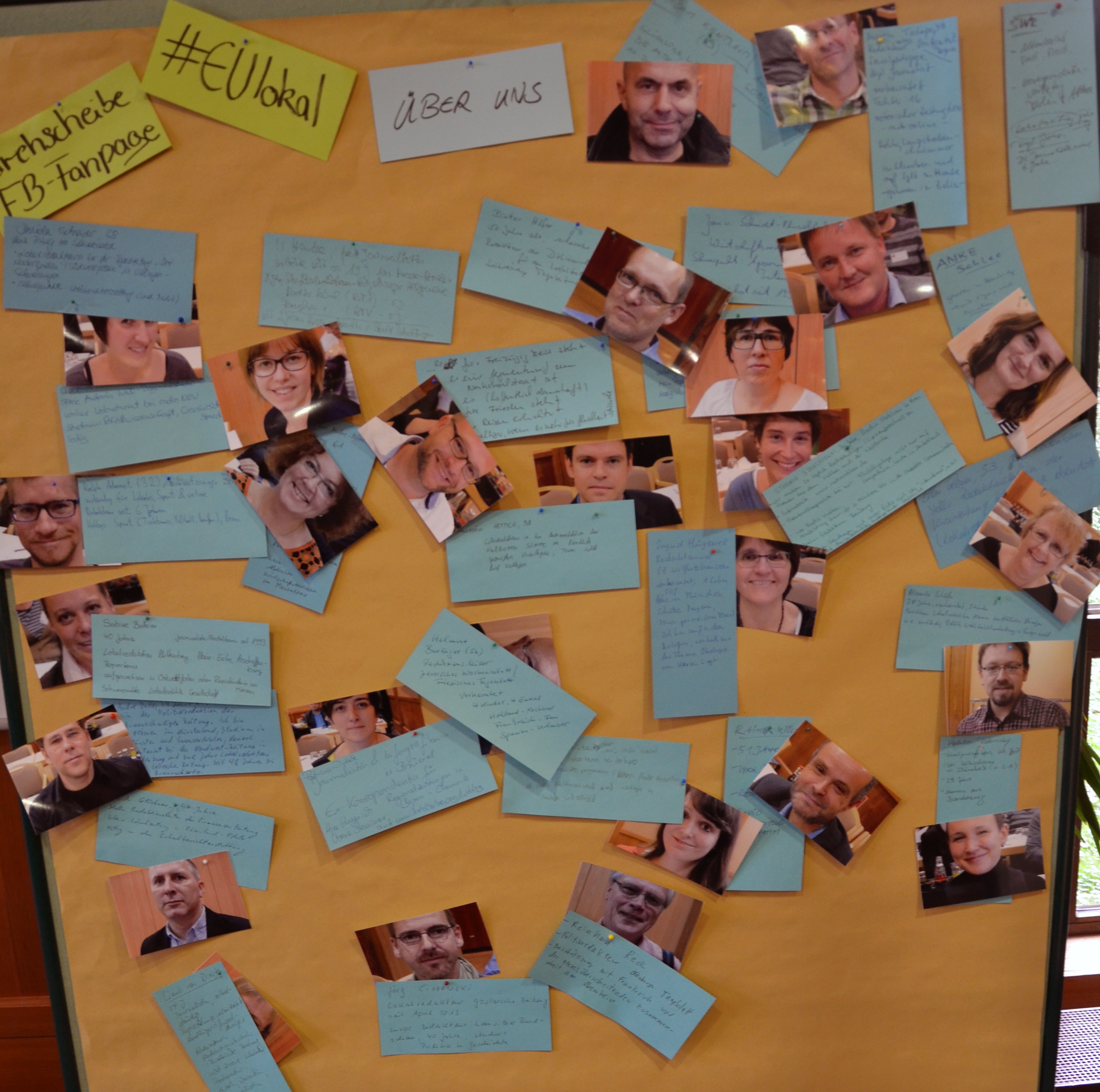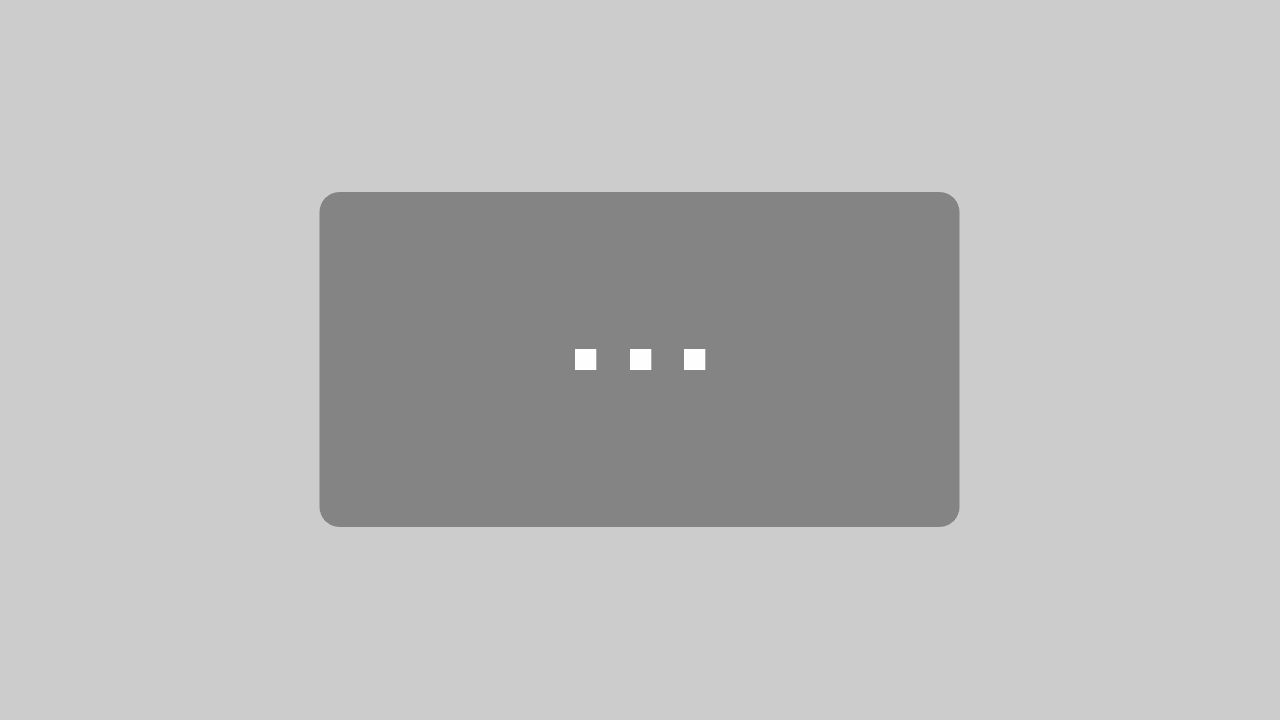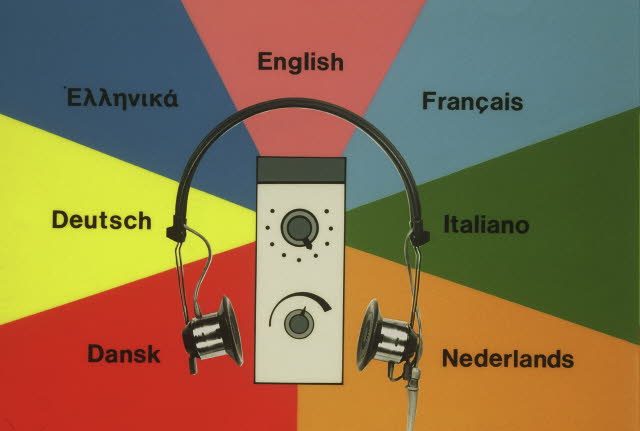Das letzte Podium auf dem Forum.
Medienwandel, Hyperlokales, journalistischer Nachwuchs – all diese Fragen wurden auf dem 21. Forum Lokaljournalismus diskutiert. Auf dem letzten Podium aber ging’s ans Eingemachte – ums liebe Geld. Zur Diskussion stand die Frage, auf die bisher wohl niemand eine befriedigende Antwort geben kann: „Wie lässt sich leistungsfähiger Lokaljournalismus finanzieren?“
Die Diskutanten waren Gerlinde Hinterleitner, Chefredakteurin von derStandard.at, Rolf-Dieter Lafrenz, Geschäftsführer der Schickler Beratungsgruppe, Karl-Heinz Ruch, Geschäftsführer der taz, Lutz Schumacher, Chefredakteur des Nordkuriers, und Thomas Krüger, Präsident der Bundeszenrale für politische Bildung. Moderator war Horst Seidenfaden, Chefredakteur der Hessischen/ Niedersächsischen Allgemeinen.
Lutz Schumacher vom Nordkurier meinte, es gebe eine „simple Antwort“ auf die Frage nach der Finanzierung von gutem Journalismus: Es gehe schlicht und einfach darum, gute journalistische Produkte herzustellen, die die Menschen kaufen wollen. Das sei nicht anders als in jeder anderen Branche. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Nachfrage gibt“, betonte er.
Lafrenz von der Schickler Beratungsgruppe indes erinnerte noch einmal daran, dass es in Zukunft weniger Geld geben werde, da Anzeigenkunden wegfallen – im Lokalen wie im Regionalen. Er verwehrte sich dagegen, dass seine Agentur immer nur mit der Vorstellung verbunden werde, sie schlage Stellenkürzungen in den Redaktionen vor. All die anderen Maßnahmen, die sie als Berater empfehlen, würden dabei vergessen.
Provokant fragte Seidenfaden, ob die Schließung von Zeitungen – wie etwa der Westfälischen Rundschau – die Lösung sei. Und was bedeute Leistungsfähigkeit, wenn die Tageszeitungen noch immer die Tagesschau von gestern abbildeten?
Bpb-Präsident Krüger meinte, es habe auch etwas mit der Frage von Leistungsfähigkeit zu tun, wenn eine Lokalzeitung den kritischen Bericht über Arbeitsbedingungen bei Lidl nicht bringe aus Angst vor dem Verlust von Anzeigen.
Karl-Heinz Ruch von der taz indes kritisierte den Begriff „leistungsfähiger Journalismus“ oder „Qualitätsjournalismus“. Journalismus sei ein Beruf, den man ausüben könne und von dem man leben könne – was den Journalisten zum Beispiel vom Blogger unterscheide. Es müssten Geschäftsmodelle gefunden werden, die mit weniger Geld auskommen und dennoch Journalisten finanzieren. Er räumte im Übrigen ein, dass der taz klar sei, dass sie keinen Lokaljournalismus könne.
Lutz Schumacher vom Nordkurier schilderte die Lage seiner Zeitung, die in einem sehr dünn besiedelten Gebiet erscheine. Trotzdem funktioniere das Konzept der Zeitung. Er sei fest davon überzeugt davon, dass Lokaljournalismus eine Zukunft habe. Nur dürfe man nicht selbstgefällig sein, man müsse mutig in die Zukunft sehen und solle nicht jammern. Den Vorwurf des Moderators, das klinge ein wenig nach „Weiter wie bisher“ wies er zurück. Es gehe darum, Ideen für die Zukunft zu entwickeln.
Schreiben, was der Leser lesen will?
Thomas Krüger betonte den kulturellen Wechsel, der durch das Internet vonstatten gehe. Dieser ermögliche es, den Leser mehr einzubeziehen. Man müsse „Kolaboration als Arbeitsprinzip“ etablieren. Lafrenz indes beobachtet eine „Halbierung des Interesses an politischer Berichterstattung“ in der Bevölkerung. „Die Leute interessiert das immer weniger“, sagte er. Aber immer noch hätten viele Zeitungen die gleiche Seitenstruktur wie früher – mit Politikteil etc.. „Haben wir nicht versagt, wenn sich die Leute nicht mehr für Entscheidungen des Gemeinderats interessieren?“, fragte daraufhin Lutz Schumacher. Dies sei ein kollektives Versagen des Lokaljournalismus.
Krüger wandte ein, dass viele Fragen nicht als Themen erkannt würden – weder von Journalisten, noch von der Bevölkerung. Solche Fragen – er erwähnte ein Beispiel zum Theme Rechte von Gefängnisinsassen – gelte es aber auch gegen den Trend aufzugreifen. Der Journalist sei angehalten, kritisch nachzufragen, das könne bei aller Ökonomie nicht links liegen gelassen werden. „Es geht darum, Fragen zu stellen, die sonst nicht gestellt werden“, sagte er.
Hinterleitner betonte, dass es nötig sei, die Leser in die journalistische Arbeit einzubeziehen – sei es über Facebook oder auf andere Art. Sie betonte aber auch, dass sie im Standard durchaus auch Geschichten erzählen würden, die sie für nötig halten, auch wenn sich zunächst nicht alle dafür interessieren.
Wie umgehen mit Online?
Ruch wies daraufhin, dass es genügend Leser gebe. „Aber sie lesen im Netz.“ Damit wandte sich die Runde dem Umgang mit der Herausforderung durch das Internet zu. Ruch erwähnte die jüngste koordinierte Adblocker-Aktion großer Tageszeitungen, die ihre Leser auffordert hatten, auf den Online-Seiten die Werbung nicht wegzuschalten, weil die Verlage diese Einnahmen bräuchten. Für die taz sei das Internet im Übrigen ein Segen: „Unsere Publizität wird gesteigert.“ Die Leser seien zahlungswillig, man müsse sie nur abholen.
„Print geht zurück, Online stagiert – und jetzt wollen wir Geld dafür verlangen?“, fragte Horst Seidenfaden erneut provokant in die Runde.
Lafrenz betonte, wenn man Inhalte kostenfrei ins Netz stelle, könne man keine Redaktion bezahlen. Die Reichweite von regionalen Medien gebe das nicht er. Die Hoffnung, dass die Anzeigenerlöse wachsen würden, sei Illusion. Man komme um Paid-Content-Modelle nicht herum. Die Online-Auftritte seien meist aber noch nicht so ausgestattet, dass jemand dafür zahlen wolle. Es gehe kein Weg an geschlossenen Abomodellen vorbei. Eine Metered Paywall, Geld für einzelne Artikel zu erlangen reiche nicht aus.
Schumacher stimmte im Prinzip zu und meinte: „Wir müssen aufhören damit, unser Produkt zu verschenken.“ Jemand, der einen Porsche im Laden ansehe, könne ihn auch nicht mit nach Hause nehmen, ohne zu bezahlen. Nötig sei es, ein gutes Produkt zu machen, dann bekomme man auch Geld dafür.
Hinterleitner wandte indes ein, dass es ein großes strategisches Problem beim Thema Paid Content gebe. Die Nachricht als solche sei so weit verbreitet, dass ihr Preis gegen null tendiere. „Für welche Nachrichten wollen wir denn Gebühren verlangen?“
Lafrenz hielt dagegen: „Die Nachrichten aus der lokalen Gemeinde gibt es nicht über Google News.“ Hinterleitner konterte: „Auch lokale Nachrichten werden zum Beispiel über Facebook schnell verbreitet.“
Wo kommt das Geld zukünftig her?
Krüger betonte zum Schluss noch einmal, dass das Produkt verkauft werden müsse. Man müsse dem Leser etwas anbieten, für das er zahle will. Es werde in den Verlagen zu wenig selbstreflektiert über die eigene Ökonomie diskutiert. Es gehöre dazu, einen selbstkritischen Diskurs zu führen und Kritikfähigkeit zu beweisen. Das Pfund sei immer noch die Credibilität der Tageszeitung, die Glaubwürdigkeit der Marke in der Region.
Für Schumacher vom Nordkurier ist klar, dass Geld von Stiftungen oder Subventionen zu nehmen, der falsche Weg sei. „Wir müssen uns dem Markt stellen“, sagte er. Man mache interessante Produkte, die gekauft werden sollten. Man solle nicht darüber nachdenken, woher das Geld komme. „Wir sollten nicht denken wie der Bergbau im Ruhrgebiet. Wenn es wirklich vorbei sein sollte – dann ist es eben so. Ich glaube aber nicht daran.“
Daran glauben wollten sicherlich die meisten Zuhörer auch nicht. Letztlich konnte die Frage nach der Finanzierung von leistungsfähigem Lokaljournalismus – erwartungsgemäß – nicht völlig geklärt werden. Die Diskussion über die Zukunft des Lokaljournalismus aber ist in vollem Gange. Zum Verzagen gibt es, wie das 21. Forum Lokaljournalismus gezeigt hat, keinerlei Anlass.