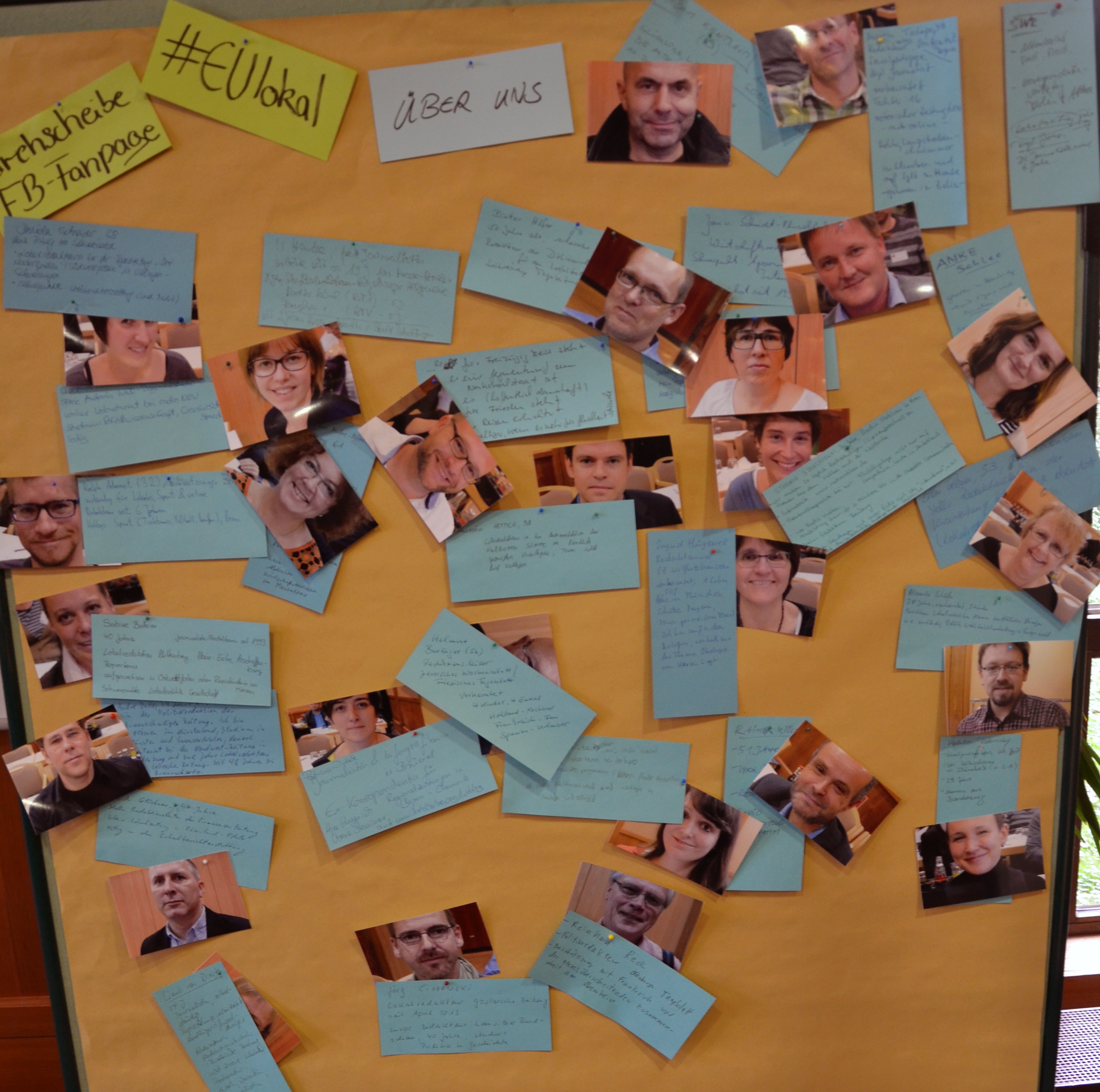Das größte Risiko im Angesicht sinkender Auflagenzahlen? Nichts tun, sagt Christian Stavik, Nachrichten-Editor der norwegischen Tageszeitung Fædrelandsvennen. Stavik war der erste der drei Referenten der Veranstaltung „Innovation im Fokus – Antworten der Gipfelstürmer“.
Seine Zeitung habe ein Bezahlmodell eingeführt, das „nichts unberührt ließ“, sagte Stavik. Ziel sei es gewesen, ein „Inside-Gefühl“ für Abonnenten zu erschaffen und zur selben Zeit für alle, die keine Abonnenten sind, das Gefühl, nur Externer zu sein.
Stavik und sein Team entschieden sich für ein Fremium-Modell. Das Resultat: Vor Einführung des Modells habe man fünf Kunden pro Tag verloren, sagte Stavik. Danach kehrte sich der Trend ins Positive um. Einen weiteren Fokus legten Stavik und sein Team auf den Facebook-Kanal der Zeitung, der inzwischen rund um die Uhr betreut wird. Zudem habe man einen Kommunikationsberater engagiert, der half, ein Team-Gefühl in der Redaktion zu schaffen.
Stavik verglich eine Redaktion mit einem Fußballteam. Redakteure, die die Print-Zeitung betreuen, rechnete er der Verteidigung zu, das Mittelfeld seien vor allem Redakteure, die die Webseiten betreuen, und die Offensive schließlich seien die Redakteure, die die Smartphones und Tablets betreuen.
Wie sich die Arbeit der Redakteure verändert habe, wollte Moderator Horst Seidenfaden von Stavik wissen. Er selbst würde viel häufiger abends arbeiten, entgegnete dieser – den Zeiten, in denen der Traffic auf der Seite am stärksten sei.
Anderes Arbeiten
Interessant waren Staviks Ausführungen, was die Änderungen für Redakteure betraf. So sei es ihnen nicht erlaubt, NICHT auf Facebook zu sein. Facebook sei das perfekte Tool, um mit den Lesern zu kommunizieren. Wenn man nicht auf Facebook sei, gehe dort die Kommunikation dennoch weiter – aber man sei eben nicht dabei. Stavik skizzierte ein Modell, in dem es den Zeitungsredakteure, wie wir ihn bisher kennen, nicht mehr gibt. Aber dank dieser Online- und Digitalstrategie haben das Medienhaus viel mehr Geschichten, aus denen es wählen könne.
Wie nahmen die Zuschauer die revolutionären Ideen aus Norwegen auf? Philipp Ostrop von den Ruhr Nachrichten fasste es in einem Tweet so zusammen: „Was fehlt: Ein Wort für die Nervosität, die man nach dem Vortrag von Stavik spürt.“